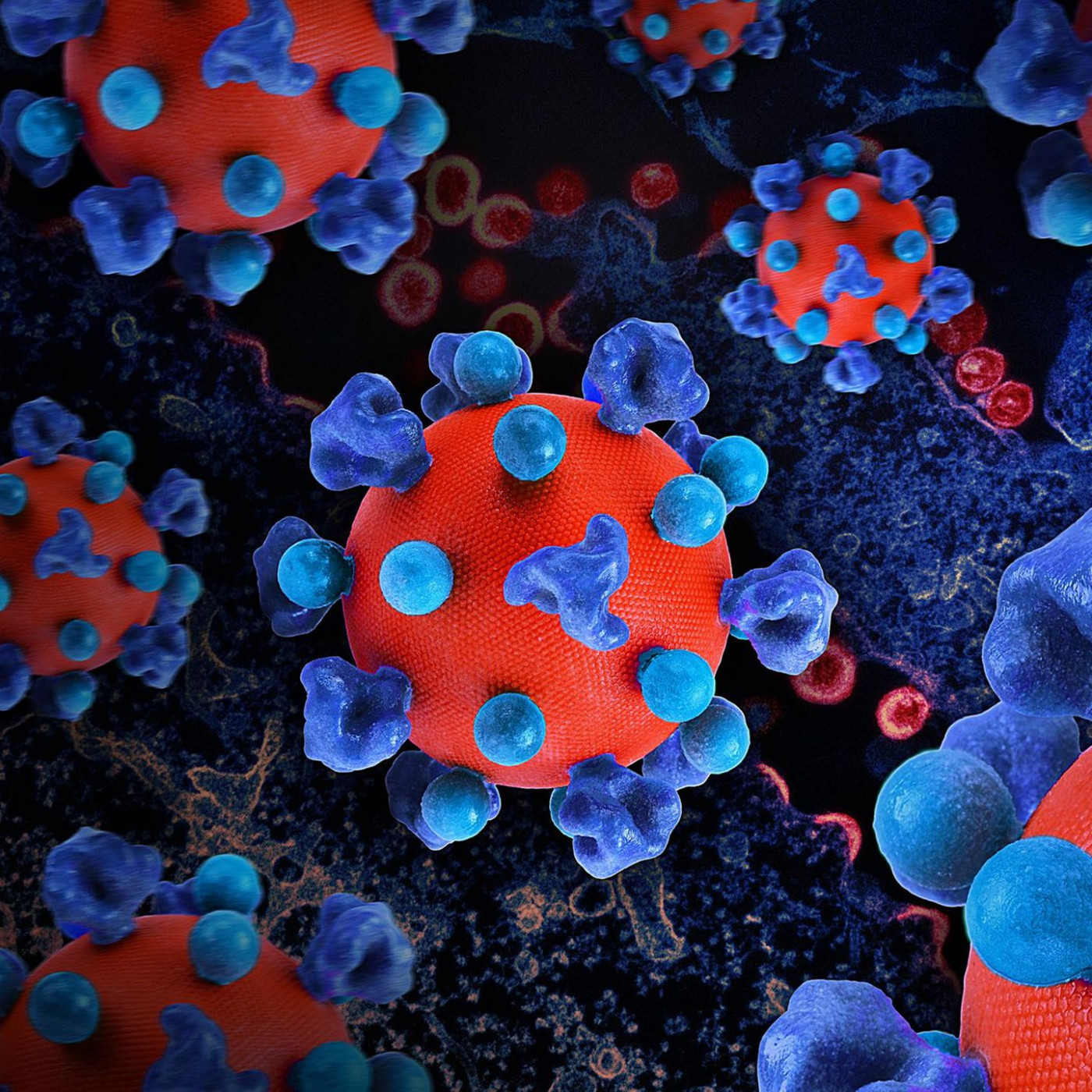Menschen leben im hoch gelegenen Gebirge, wo der Sauerstoffgehalt der Luft geringer ist, am Wasser, wodurch Tauchen für sie eine zentrale Rolle spielt, in Wüsten sowie in eisigen Gebieten, wo sie kaum Landwirtschaft betreiben können. Ihre Fähigkeit, sich an die jeweilige Umgebung anzupassen, beruht oft auf kulturellen Anpassungen. Aber nicht nur: Tatsächlich finden sich auch im Erbgut des Homo sapiens charakteristische Unterschiede.
Die Evolution verändert Menschen, und das in bestimmten Fällen erstaunlich schnell. „Das kann innerhalb von zehn Generationen geschehen, aber in 100 Generationen kann man auf jeden Fall eine Veränderung erkennen“, sagt Diethard Tautz. Der emeritierte Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön beschäftigt sich mit den molekularen Grundlagen der Evolution und genetischen Prozessen der natürlichen Selektion. „Evolution findet kontinuierlich um uns herum statt – bei Pflanzen, Tieren und Menschen“, betont der Molekularbiologe. Und nach Charles Darwins Konzept der Evolution, „survival of the fittest“, überleben vor allem die Anpassungsfähigsten.
Höhentraining der Evolution
Zwei jüngst veröffentlichte Studien untersuchen Effekte, die sich – evolutionär gesehen – wohl erst vor relativ kurzer Zeit herausgebildet haben. Eine befasst sich mit den Sherpas im Himalaja. Diese Gruppe lebt seit einigen Tausend Jahren auf dem tibetischen Hochplateau, in einer Höhe von etwa 4000 bis 4500 Metern. Ihre Mitglieder arbeiten oft als Bergführer und Träger für Bergsteiger aus anderen Teilen der Welt. Wie Forscher im Fachjournal „PNAS“ berichten, konnten sich die untersuchten Sherpas bei einem Aufstieg auf 4300 Meter nachweislich schneller an die Höhe anpassen als Menschen aus dem Tiefland.
Sowohl die Sauerstoffaufnahme als auch der pH-Wert des Blutes müssten dabei ausgeglichen werden, erläutert Studienleiter Trevor Day von der Mount Royal University im kanadischen Calgary. Wenn Menschen in größere Höhen kommen, führt der geringere Sauerstoffgehalt der Luft zu einer verstärkten Atmung. Auf diese Weise wird weiter ausreichend Sauerstoff aufgenommen.
Dies hat laut Day zur Folge, dass der CO2-Gehalt im Blut sinkt. Das stört den Säure-Basen-Haushalt. Die Nieren können diese Störung beheben, indem sie bestimmte chemische Verbindungen über den Urin ausscheiden, wodurch sich der pH-Wert des Blutes wieder normalisiert.
Schon bekannt war, dass die Atemwege der Sherpas besser an den Sauerstoffgehalt in großen Höhen angepasst sind. Das Team um Trevor Day zeigte nun, dass die Nieren ebenfalls an der schnellen Akklimatisierung beteiligt sind. Dies könnte auf einen Selektionsdruck auf die Fähigkeit zur Anpassung an Höhenlagen der tibetischen Hochlandpopulationen hindeuten, sagt Day.
Die zweite Studie befasst sich mit Menschen in Grönland. Eine Vergleichsanalyse des Erbguts von fast 6000 Menschen der Insel legt nahe, dass die Vorfahren – aus dem Gebiet der heute kanadischen Arktis – der heutigen Bevölkerung vor weniger als 1000 Jahren den Nordwesten der Insel erreichten. Einige der entdeckten Genvarianten scheinen Anpassungen an das Leben in der Arktis zu sein, heißt es in der Studie eines Teams der Universität in Kopenhagener im Fachmagazin „Nature“.
Zahlreiche grönländische Inuit tragen in ihrem Genom etwa eine bestimmte Variante, die den Stoffwechsel von Fettsäuren beeinflusst. Das könne mit dem Verzehr von Lebensmitteln zusammenhängen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, berichten die Forscher, etwa Robben- oder Walfleisch. „Die traditionelle, fett- und proteinreiche grönländische Ernährung hat zu einer natürlichen Selektion in einer genomischen Region auf Chromosom 11 geführt.“ Die spezifischen Gene beeinflussen aber auch die Art der Krankheiten in der grönländischen Bevölkerung.
Evolutionsbiologe Tautz nennt ein weiteres Beispiel, an dem deutlich wird, wie die Weitergabe von kulturellen Gepflogenheiten Auswirkungen auf den Genpool von Menschen haben. So haben viele Europäerinnen und Europäer heutzutage die Fähigkeit, nach der Kindheit noch Milchzucker zu verdauen. Diese Laktosetoleranz war vor etwa 10.000 Jahren nicht so weit verbreitet.
Doch dann ermöglichte die zunehmende Domestizierung von Rindern, Schafen und Ziegen ihren Haltern, täglich Milch zu trinken. Das könnte ein Selektionsvorteil für jene Menschen gewesen sein, die eine Genvariante für ein bestimmtes Enzym aufwiesen, welche sie auch als Erwachsene befähigt, Milch zu vertragen. „Diese Genvariante ist jetzt bei Europäern besonders häufig, und sie ist ein Modellbeispiel einer genetischen Signatur für eine schnelle Evolution“, sagt Tautz.
„Es gibt eine kontinuierliche Anpassung, auch jetzt noch“, führt er aus. So habe es in den vergangenen Jahrzehnten in jenen Teilen Afrikas, wo die Immunschwächekrankheit Aids viele Todesopfer forderte, einen Vorteil für Menschen mit Resistenzen gegen das HI-Virus gegeben. Noch sei es etwas früh, um die Effekte zu messen. „Aber in fünf bis zehn Generationen kann man die sicher feststellen“, ist er überzeugt.
Körper stellten immer einen Kompromiss dar, sagt Axel Meyer, der an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie innehat. Es sei mitnichten so, dass Evolution nach Perfektion strebe. Sondern natürliche Selektion führe lediglich dazu, dass aus der Auswahl der zur Verfügung stehenden Genkombinationen eine bestimmte Kombination mehr Nachkommen hinterlasse als eine andere – jene, die sich unter den jeweiligen Bedingungen besonders bewährt.
Das zeige auch die Tatsache, dass die Menschen heute noch evolutionäres Gepäck mit sich herumtragen, sprich Überbleibsel, die keinen Vorteil mehr bringen, aber die auch nur wenig Einfluss auf das Sterberisiko haben. Ein Beispiel sei der Blinddarm, sagt Meyer. „Das ist sehr wahrscheinlich ein Relikt der Evolution, wir haben ihn wohl aufgrund unserer Pflanzen-fressenden Vorfahren.“
Vom nomadischen Jäger zum sitzenden Scroller
Es entstünden auch keine neuen Mutationen, nur weil es von Vorteil wäre, bestimmte Mutationen zu haben, also in der modernen Welt beispielsweise welche, die den Menschen beim Sitzen und Scrollen helfen statt beim Jagen und Sammeln. „Sondern es funktioniert so, dass bestimmte Varianten vorhanden sind und dann eher vererbt werden, weil sie einen Vorteil bieten, als die, die von Nachteil sind“, erklärt Meyer.
Allerdings könne die moderne Medizin einen gewissen Einfluss nehmen. Bürger im wohlhabenden Westen hätten die Selektion zu einem gewissen Teil ausgeschaltet, sagt Meyer: „Woran die Menschen vor zwei, drei oder vier Generationen noch gestorben sind, das überleben wir heute.“
Dazu gehören Krankheiten, die vererbt werden können, etwa die Bluterkrankheit Hämophilie, die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose oder auch multifaktorielle Krankheiten mit genetischer Veranlagung, wie Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die jeweils daran beteiligten Genvarianten können heute häufiger vererbt werden, weil sie seltener zum vorzeitigen Tod führen.
Über ein weiteres Beispiel von evolutionärer Veränderung durch medizinischen Fortschritt schreibt der Evolutionsbiologe Philipp Mitteröcker von der Universität Wien. Er beschäftigt sich etwa mit dem menschlichen Becken, das auch den Geburtskanal bildet. Je größer ein Neugeborenes ist, desto höher sei die Überlebenschance nach der Geburt, aber desto größer sei auch das Risiko, dass der Kopf des Kindes zu groß sei, um durch das Becken zu passen.
Da es seit Mitte des 20. Jahrhunderts viele Kaiserschnitte gebe, könnten auch schmale Frauen relativ gefahrlos große Kinder gebären. Mitteröcker schätzt, dass durch Kaiserschnitte die Rate an Schädel-Becken Missverhältnissen in den vergangenen 60 Jahren um etwa einen halben Prozentpunkt zugenommen hat.
Außerdem habe die Reproduktionsmedizin möglicherweise Auswirkungen auf die Gene einer Bevölkerung, meint Meyer. So würden Samen- und Eizellspenden von besonders intelligenten oder athletischen Spendern und Spenderinnen bevorzugt – diese hätten also häufiger Nachwuchs als weniger intelligente und athletische Menschen. „Da findet schon eine Selektion statt“, zumindest bei den Spendern und Spenderinnen, sagt der Evolutionsbiologe.
Selektion durch künstliche Befruchtung
Die In-vitro-Fertilisation ermögliche außerdem, dass Menschen, die sonst auf natürlichem Weg wohl keine Kinder bekommen hätten, nun welche bekommen könnten, fügt Frank Rühli vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich hinzu. „Das führt möglicherweise, wenn das erbliche Faktoren sind, zu Veränderungen im Genpool.“
Der Mensch beeinflusst die Evolution also bereits, indem er der natürlichen Selektion teilweise entkommt. Und was ist andererseits mit der Medizin, mit der sich theoretisch verhindern lässt, dass bestimmte Erbkrankheiten weitergegeben werden – also mit Präimplantationsdiagnostik und ähnlichen Methoden? Jenen Untersuchungen, die dazu dienen, um zu entscheiden, ob ein Embryo aus dem Labor eingesetzt werden soll, oder nicht? „Diese hat noch sehr geringe Effekte“, sagt Meyer, denn sie werde nur sehr vereinzelt angewandt. Der Einfluss auf die Menschheit sei deswegen bisher nur sehr langsam sichtbar.
Zur Frage des evolutionären Effekts der Ansammlung von Mutationen wurde im vergangenen Jahr eine Studie zu Versuchen an Mäusen in „PLOS Biology“ veröffentlicht, an der Tautz beteiligt war. Die Ergebnisse zeigten, dass die Ansammlung potenziell schädlicher Genvarianten nur sehr langsam zu einem evolutionären Fitnessverlust in Populationen führt.
Auf den Menschen übertragen bedeuten diese Ergebnisse, dass der mögliche Verlust an Fitness durch die Errungenschaften moderner Medizin „in absehbarer Zukunft“ kein Anlass zu Sorge sein muss.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke