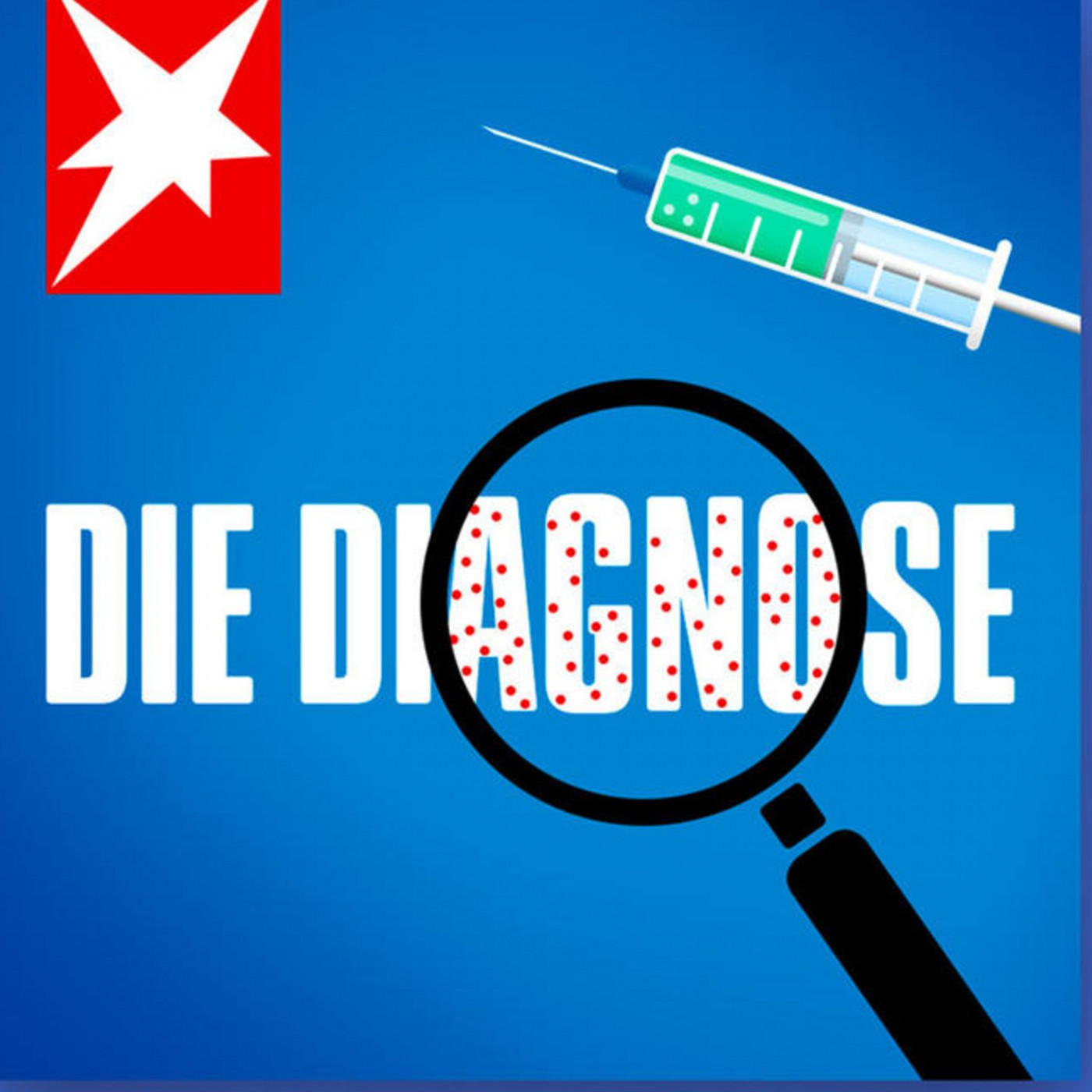Blickt man in den späten Abendstunden nach Süden, so erkennt man mitten in der Milchstraße das große Sommerdreieck. Es besteht aus den hellen Sternen Deneb im Schwan, Atair im Adler und Wega in der Leier. Unter dem eindrucksvollen Sternendreieck findet man das zum Tierkreis zählende Sternbild Schütze, dem im Südosten der Steinbock folgt.
Im Osten sind die Herbststernbilder Andromeda und Pegasus aufgegangen. Den Pegasus nennt man auch Herbstviereck oder Herbstquadrat. Der östliche Stern des großen Quadrats gehört streng genommen zur Andromeda. Im Nordosten findet man die Kassiopeia, das „W“ am Himmel, und den Perseus.
Im Südwesten erkennt man das ausgedehnte Sternbild Schlangenträger und das Sommersternbild Herkules. Der Große Wagen steht im Nordwesten. Der Himmelswagen ist nur ein Bestandteil des Großen Bären, dem im Westen der Bärenhüter oder Bootes folgt.
Die Mehrzahl der Planeten sucht man abends vergeblich. Nur Saturn geht Anfang des Monats kurz vor 23 Uhr im Osten auf; Mitte August erscheint der Ringplanet schon kurz vor 22 Uhr am Osthorizont. Am Morgenhimmel sind dagegen mehrere Planeten zu sehen. Venus ist nach wie vor heller Morgenstern, Anfang August geht dieser kurz vor 3 Uhr im Nordosten auf.
Der in unseren Breiten schwer beobachtbare sonnennächste Planet Merkur gibt ebenfalls ein Gastspiel am Morgenhimmel. Etwa vom 19. bis 29. des Monats erkennt man ihn als helles Gestirn kurz nach 5 Uhr am Nordosthorizont. Der Riesenplanet Jupiter erscheint Anfang August ab 3.30 Uhr ebenfalls im Nordosten.
Am 12. des Monats kommt es zu einer eindrucksvollen Konstellation: Venus läuft ganz nah an Jupiter vorbei. Selten bilden die beiden hellsten Planeten ein so schönes Doppelgestirn. Die beste Beobachtungszeit ist am frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr.
Der August wird auch Sternschnuppenmonat genannt. Vom 1. bis 24. des Monats scheinen aus dem Sternbild Perseus viele Sternschnuppen oder Meteore zu kommen, die man deshalb Perseiden nennt.
Besonders in der Nacht vom 12. auf den 13. August sind zahlreiche Sternschnuppen zu erwarten. Manchmal werden mehr als 100 Meteore pro Stunde gezählt. Darunter sind auch helle Objekte, die sich trotz Mondlicht detailiert beobachten lassen.
WELT-Autor Erich Übelacker ist Astronom, hat in Stuttgart studiert und in Paris promoviert. Von 1975 bis 2000 war Erich Übelacker Leiter des Hamburger Planetariums, zuvor arbeitete er bei Carl Zeiss in Oberkochen als Leiter des Fernrohrlabors und der Planetariumsabteilung.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke