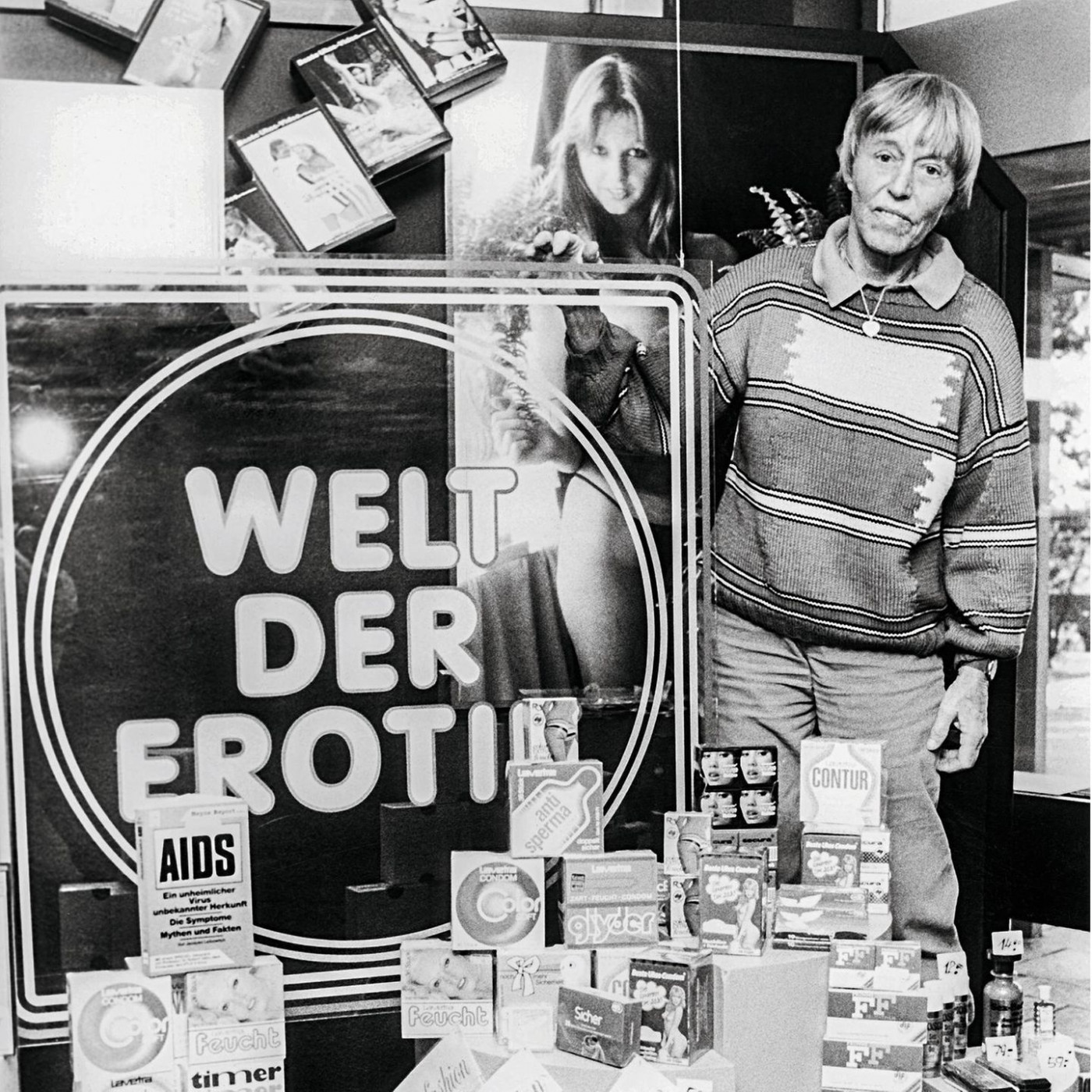Eigentlich dachten Beobachter, Chinas Präsident Xi Jinping hätte raus, wie er mit US-Präsident Donald Trump umgehen muss. Es war im Mai 2018, und die Trump-Regierung hatte harte Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationskonzern ZTE verhängt, weil das Unternehmen mit dem Iran und Nordkorea Geschäfte gemacht hatte. Wegen des US-Embargos drohte der Firma innerhalb weniger Wochen die Pleite.
Mit einem Anruf konnte Xi den US-Präsidenten umstimmen – mit welchen Zugeständnissen, Drohungen oder Argumenten genau, ist nicht bekannt. Klar ist nur: Am Ende setzte Trump einen Tweet ab: „Präsident Xi und ich arbeiten daran, dass ZTE schnell wieder ins Geschäft kommt.“
Ganz so schnell dürfte es diesmal nicht gehen, obwohl derzeit weit mehr auf dem Spiel steht als das Schicksal eines einzigen Unternehmens. Der Handelskonflikt, den Trump im März mit Strafzöllen von zehn Prozent auf chinesische Güter startete, ist schnell eskaliert.
Inzwischen sind die gegenseitigen Strafzölle so hoch, dass sie den Handel zwischen beiden Ländern de facto stoppen werden: Güter aus China müssen bei der Einfuhr in die USA mit bis zu 145 Prozent verzollt werden. Für US-Produkte, die nach China verkauft werden, gelten inzwischen 125 Prozent. Weiter werden sie nicht steigen, erklärte die Führung in Peking. Die US-Strafzölle seien ohnehin bereits ein „Witz der Weltwirtschaftsgeschichte“.
Lustig ist an dem Zollstreit allerdings wenig. Die beiden größten Volkswirtschaften und Militärmächte der Erde haben sich in einen Kampf verrannt, der Märkte verschreckt, Preise steigen lässt, Jobs kosten wird und den Rest der Welt in Mitleidenschaft zieht. China-Beobachter gehen zwar davon aus, dass beide Seiten eine Lösung für den Streit finden werden. Sie warnen aber auch, dass der Konflikt schnell entgleiten kann, mit Folgen, die weit über die wirtschaftlichen Konsequenzen hinausgehen.
Der aktuelle Streit ist der vorläufige Tiefpunkt einer langfristigen Entwicklung. Tatsächlich hat Trump mit seiner Zollentscheidung bildlich gesprochen nur die Vorspultaste gedrückt: China und die USA, die um die geopolitische Vorherrschaft im 21. Jahrhundert ringen, sind seit Jahren dabei, sich wirtschaftlich zu entkoppeln.
Trump begann damit in seiner ersten Amtszeit, und sein Nachfolger Joe Biden setzte diese Politik fort, unter anderem, indem er bestimmten chinesischen Unternehmen verbot, in den USA zu investieren, und den Verkauf modernster Chips nach China untersagte, um den technologischen Aufstieg des Landes zu behindern. Partner wie die Niederlande wurden unter Druck gesetzt, bis sie Exporte wie etwa Maschinen zur Herstellung von Halbleitern ebenfalls verboten.
Nach innen repressiver, nach außen aggressiver
China seinerseits hat sich seit der Amtsübernahme von Xi Jinping, der 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei wurde, politisch und wirtschaftlich vom Westen abgewendet: Das Regime in Peking wurde nach innen repressiver und nach außen aggressiver, machte unter dem Etikett der Korruptionsbekämpfung Jagd auf Kritiker von Xi und beanspruchte Territorien im Südchinesischen Meer.
Gleichzeitig reduzierte Xi die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten: Machten die Geschäfte mit US-Kunden 2009 noch ein Viertel aller chinesischen Exporte aus, fiel der Anteil bis Ende 2023 je nach Messung auf nur noch rund 13 Prozent. Das hat chinesische Unternehmen ein Stück weit auf die drohenden Strafzölle vorbereitet. Beide Volkswirtschaften sind derweil ähnlich exponiert: US-Verkäufe nach China machten 2023 ebenfalls 14 Prozent der amerikanischen Auslandsgeschäfte aus.
Daneben hat China in vielen kleinen Schritten, von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, mal diese, mal jene wirtschaftliche Verbindung zu den USA gekappt: Importeure wurden angewiesen, Sojabohnen, Flüssiggas und andere Produkte bei nichtamerikanischen Anbietern zu kaufen. Die Regierung hat mit strengen Regeln und Auflagen etwa zur Datenspeicherung US-Firmen aus dem Land getrieben: Unternehmen wie IBM, Amazon und Airbnb haben den Markt bereits ganz oder teilweise verlassen. Die Dienste von Google oder Meta sind dort ohnehin gesperrt.
Firmen aus dem Rüstungsbereich wie Lockheed Martin oder Palantir wurden auf schwarze Listen gesetzt oder ihnen wurden gleich die Geschäfte verboten. „Xi hat die chinesische Wirtschaft in den vergangenen Jahren mit vielen nach außen kaum wahrgenommenen Maßnahmen auf einen langwierigen Kampf mit den USA vorbereitet“, sagt Jacob Gunter, Ökonom bei der Forschungseinrichtung Mercator Institute for China Studies (Merics). „China ist heute in vielen Schlüsselbereichen mit seiner breiten Produktionsbasis und oft vollständigen Lieferketten weitgehend autark und in dieser Hinsicht den USA weit voraus.“
Die radikale Zollpolitik Trumps und die chinesischen Gegenmaßnahmen haben diese Entwicklung abrupt beschleunigt. Jetzt müssen es die beiden Weltmächte schaffen, den Konflikt zu entschärfen. „Das Risiko ist groß, dass, was im Handel anfängt, in viel gefährlichere Bereiche überschwappt“, sagt George Magnus vom China Centre der Oxford University. „Die beiden Länder könnten Handel und Finanzgeschäfte mit dem jeweils anderen verbieten, so wie wir das bei Russland sehen. Wenn die Eskalation weitergeht, kann der Konflikt auf Taiwan und das Südchinesische Meer überspringen.“ Deshalb müsse der Handelsstreit dringend gelöst oder zumindest zeitweise beigelegt werden.
Magnus, ein langjähriger Beobachter chinesischer Politik und Wirtschaft, hält es für möglich, dass Trump und Xi in den kommenden Wochen eine gemeinsame Verhandlungsbasis ausloten – allerdings könnte sich dieser Prozess ebenso gut über mehrere Monate hinziehen. Gegenwärtig könnten sich beide Männer von ihren Extrempositionen kaum zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren. „Meine Hoffnung ist, dass der wirtschaftliche Schmerz auf beiden Seiten so groß wird, dass zumindest die extremen Maßnahmen zurückgenommen werden“, sagt Magnus.
Der Streit kostet Wachstum und Wohlstand
Wer die besseren Karten in den Verhandlungen hat, darüber sind sich Beobachter nicht einig. Diese Überlegungen sind allerdings auch müßig: Der Streit kostet bereits heute in beiden Staaten Wachstum und Wohlstand. Ökonomen haben die Wachstumsaussichten für beide Länder zurückgenommen. Trump, dem die hohe Inflation und Existenzängste der Mittelschicht ins Amt geholfen haben, droht eine Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen 2026, wenn Preise wegen der Zölle steigen.
In China drohen Fabrikschließungen und Jobverluste und das in einer Zeit, in der das Land ohnehin im Krisenmodus treibt: Die Wirtschaft ächzt unter einer Immobilienkrise, hoher Jugendarbeitslosigkeit und verängstigten Verbrauchern, die kein Geld mehr ausgeben. Die Führung in Peking hat zwar einen neuen Nationalismus gesät, der durch die US-Zölle weiter gestärkt wird und dafür sorgt, dass chinesische Verbraucher US-Marken meiden und heimische Produzenten unterstützen. Xi hat zuletzt zudem die Leidensfähigkeit der Bevölkerung betont oder die „Fähigkeit, Bitterkeit zu essen“.
Gleichwohl muss auch Peking die erhebliche Unzufriedenheit in der Bevölkerung ernst nehmen, vor allem weil die prekäre wirtschaftliche Entwicklung den bisherigen Gesellschaftsvertrag zersetzt: Die Führung bietet Stabilität und steigenden Wohlstand, dafür akzeptieren die Menschen autoritäre Kontrolle.
Die Zeichen stehen zwar auf noch mehr Chaos, aber letztlich dürften beide Seiten an den Verhandlungstisch finden. Trump wird nicht müde zu betonen, dass er Xi schätze und bereit für Verhandlungen sei. „Wir sind zuversichtlich, dass wir etwas mit China ausarbeiten werden“, sagte der Republikaner am Freitag.
Xi seinerseits soll bereits einen Verhandler nominiert haben und hat damit begonnen, die eigene Position für Verhandlungen zu verbessern: Peking hat neue Exportkontrollen von speziellen Magneten und sechs Seltenen Erden verhängt, die nur in China verarbeitet werden und für Autos, Roboter, Drohnen, Laser, Halbleiter oder Raketen nötig sind. Urlauber werden vor Reisen in die USA gewarnt und junge Chinesen davor, an amerikanischen Unis zu studieren. Airlines sind offenbar angewiesen, keine Flugzeuge mehr beim US-Flugzeugbauer Boeing zu kaufen und bereits bestellte Maschinen nicht abzunehmen.
In Peking kursiert derweil eine Liste mit weiteren Maßnahmen, um die US-Regierung zu Gesprächen zu bewegen, darunter ein Importstopp für Hollywood-Filme, Einfuhrverbote für Hühnchen und Handelsschranken für Dienstleistungen, etwa von US-Banken.
Zu viel erwarten sollte die Welt von einer Einigung nicht: Schon vor dem Zollstreit war das Verhältnis der beiden Weltmächte schlecht, und China-Experten rechnen nicht damit, dass es sich grundlegend verbessern wird. „Irgendwann könnten Xi und Trump sich hinsetzen und sich einigen“, sagt Merics-Experte Gunter. „Aber egal, was beide Seiten vereinbaren, es wird nicht nachhaltig sein.“ Die wirtschaftlichen, technologischen und geopolitischen Differenzen seien nicht mehr überbrückbar.
Vor allem bleibt ein Grundproblem: China flutet die Welt mit Waren, kauft aber zu wenig von anderen. Allein im vergangenen Jahr wuchsen die Exporte Chinas laut Oxford-University-Beobachter Magnus viermal stärker als der Welthandel, während die Importe des Landes stagnieren. Das hat auch Folgen für Europa: Sollten sich China und die USA nicht einigen, drohen schlechtere Geschäfte für europäische Unternehmen.
Zudem könnten Waren aus China teilweise umgeleitet werden – auch wenn dies für Entwicklungs- und Schwellenländer weit gefährlicher wäre als für Europa. „Für europäische Unternehmen wären umgeleitete chinesische Exporte nicht existenzbedrohend“, sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. „Die EU hat Mittel und Expertise, sich zu wehren.“ Kurzfristig könnten deutsche und europäische Firmen von dem Zollstreit sogar profitieren, weil sie in den USA chinesische Importe ersetzen können und in China amerikanische. Es ist ein Hoffnungsschimmer in einem Konflikt, der die Weltwirtschaft nachhaltig verändern wird.
Tobias Kaiser ist Korrespondent für europäische Wirtschaft. Er verfolgt andere europäische Volkswirtschaften und berichtet vor Ort über Entwicklungen und deren Folgen für Deutschland.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke