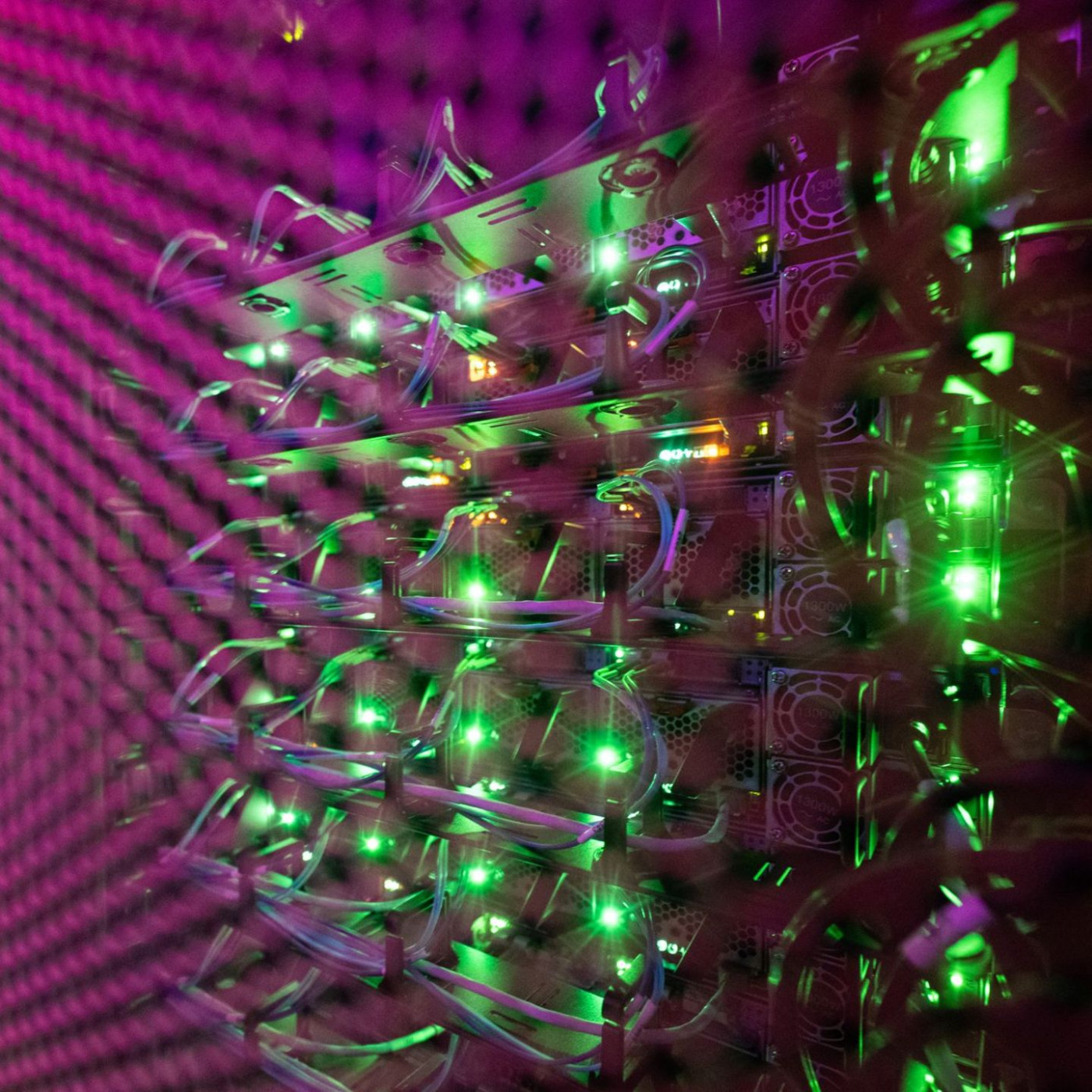Italien hat eine politische Stabilität erreicht, die lange Zeit eigentlich ein Markenzeichen der französischen Politik war. Die Regierung von Giorgia Meloni schafft es langsam aber stetig, den Schuldenstand auf niedrigere Niveaus herunterzuführen. Nun haben beide Länder die Rollen getauscht – als größtes Risiko für den Fortbestand der Euro-Zone gilt inzwischen Frankreich.
Was freilich ein schwacher Trost für Rom ist, denn auch als Einäugiger unter Blinden muss die Regierung weiter händeringend nach Einnahmequellen suchen, um den maroden Haushalt zu entlasten und eine geplante steuerliche Entlastung der Mittelschicht gegenzufinanzieren: Trotz ermutigender Signale liegt die Verschuldung des Stiefelstaates noch immer bei gut 135 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Maastricht-Kriterien der EU erlauben einen Schuldenstand von 60 Prozent des BIP.
Was also tun, fragte man sich in Melonis Koalition. Eine Idee im Haushaltsentwurf von Finanzminister Giancarlo Giorgetti war, die Kurzzeitvermietung über Ferienwohnungsplattformen wie Airbnb härter zu besteuern. Doch die Regierungsparteien Forza Italia und Lega fürchteten, die Idee könnte in der Bevölkerung auf geringe Akzeptanz stoßen. Stattdessen entwickelten sie einen Vorschlag, von dem sie sich weniger Gegenwind erhoffen, wie zuerst die „Financial Times“ berichtete.
Er zielt ab auf die große Affinität der Italiener zum Gold, die sich längst nicht im dritten Platz des Landes im globalen Ranking der Goldreserven der Notenbanken erschöpft. Im Gegensatz zu deren 2451 Tonnen liegen genaue Daten zum privaten Goldbesitz zwar nicht vor. Der Goldanalyst Jan Nieuwenhuijs allerdings schätzte die Bestände 2020 auf rund 5700 Tonnen zum aktuellen Wert von 627 Milliarden Euro – die Liebe der Italiener zum gelben Metall ist also Legende.
In einem Land, das mit der Lira über Jahrzehnte eine traditionell schwache Währung hatte, hat Gold in vielen Familien als Wertspeicher seinen festen Platz. Der frühere stellvertretende italienische Notenbankchef Salvatore Rossi schrieb in seinem Buch „Oro“ (Gold), das Metall sei für die Italiener wie das Familiensilber, wie Großvaters wertvolle Armbanduhr. „Es ist die letzte Instanz in Zeiten von Krisen, die das Vertrauen ins Land schwächen.“
Und dieses Gold, dessen Wert sich allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt hat, weckt nun Begehrlichkeiten im Palazzo Chigi. Denn das Gold in den Familien ist oft über Generationen weitergegeben worden, Dokumente über Anschaffung und damit Kaufpreis fehlen häufig. Wer dieses Gold verkaufen möchte, muss nach jetziger Regelung auf den gesamten Verkaufserlös eine Kapitalertragsteuer von 26 Prozent zahlen.
Allen, die davon betroffen sind, will man nun ein Angebot machen: mit einer einmaligen Abgabe von 12,5 Prozent auf den aktuellen Wert würde das Edelmetall quasi legalisiert, bei künftigen Verkäufen fiele die Kapitalertragsteuer lediglich auf den Gewinn an. Der Plan ist, eine Nachmeldefrist bis Mitte 2026 einzurichten. Die Regierung erhofft sich von dem Deal Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro.
Fachleute begegnen der Idee mit großer Skepsis. „Vorschläge wie diese tauchen immer wieder auf, wenn Regierungen in Schulden ertrinken und darum ringen, irgendwoher neue Staatseinnahmen zu generieren“, so Analyst Nieuwenhuijs gegenüber WELT. „Ich bezweifle, dass viele Gold-Eigentümer ihre Bestände deklarieren würden, wenn so ein Gesetz durchkäme. Letztlich halten die Menschen ja Gold genau deshalb, um die Auswirkungen finanzieller Manipulation durch Regierungen oder Zentralbanken auf sich möglichst gering zu halten.“
Am Ende werde eine solche Regelung vor allem den Schwarzmarkt stärken. Ähnlich sieht das Mike Maharrey, Marktanalyst bei Moneymetals.com. „Niemand, der noch seinen gesunden Menschenverstand hat, wird sein Gold deklarieren und Steuern darauf zahlen, wenn man es untereinander handeln und gemeinsam die Steuer vermeiden kann.“ Die Menschen täten gut daran, ihre Vorräte an Gold geheim zu halten. Man wisse nie, wann man es brauchen könne.
Die Sorge, dass steigende Vermögenspreise bei den klammen Staaten – gerade musste die Europäische Kommission in ihrer Herbstprognose die desolate Haushaltslage der EU-Mitgliedstaaten eingestehen – Begehrlichkeiten wecken, kommt nicht von ungefähr. Eine Reihe nicht beliebig vermehrbarer Sachwerte hat in den vergangenen knapp 15 Jahren von der Notenbankpolitik des billigen Geldes profitiert und quasi gegenüber dem aufgeblähten Euro aufgewertet. Dazu zählen neben Gold auch Aktien, der Bitcoin und Immobilien in guten Lagen.
Das ist auch der Politik in Deutschland nicht entgangen. Bei linken Parteien gehört der Ruf nach Vermögensteuer und reformierter Erbschaftsteuer quasi eh zur Umverteilungsfolklore. Und der Bremer Landesverband der SPD ließ sich auf seiner Suche nach Einnahmequellen von einer Maßnahme im Weltkriegs-Kontext inspirieren – dort schielt man auf die „Windfall profits“, die die Euro-Rettungspolitik Eigentümern von Immobilien bescherte. „Wir halten es für geboten, dass ein Lastenausgleich vorgenommen wird, ähnlich dem, wie er nach den großen Verwerfungen durch den Zweiten Weltkrieg in den frühen Jahren der Bundesrepublik vorgenommen wurde“, heißt es im „Zukunftsprogramm“ von 2023.
Vermögensregister für die EU?
Und jüngst forderte der Seeheimer Kreis, die Gruppierung der Genossen, die eigentlich mit dem Attribut „konservativ“ bedacht wird, das Ende der Steuerfreiheit für Gewinne aus Kryptoanlagen wie Bitcoin sowie aus Immobilieninvestments. Gold, dessen Gewinne in Deutschland nach einem Jahr steuerfrei sind, blieb in dem Strategiepapier unerwähnt.
Anläufe, an diese Steuerfreiheit heranzugehen, gab es allerdings bereits durchaus. Im Sommer 2020 plante das damals vom späteren Kanzler Olaf Scholz geführte Finanzministerium eine Veränderung der Steuerpraxis bei sogenannten Gold-ETCs wie Xetra Gold, die die Möglichkeit zur Auslieferung des Edelmetalls vorsehen. Anteilseignern sollte die Steuerfreiheit der Gewinne nach einem Jahr gestrichen werden. Damals wurde der Plan kurz danach gestoppt.
Bedeutsam könnte der italienische Plan aber auch mit Blick auf die Erfassung von Vermögensdaten werden. Überall in der Euro-Zone wird unter Verweis auf den Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität das Netz der Finanzströme enger gezogen, werden Höchstgrenzen bei der Barzahlung abgesenkt und gibt es Bestrebungen, möglichst viele Daten zu erfassen, die Rückschlüsse auf das Vermögen der Bürger zulassen. Wer sein Gold deklariert, wäre damit schon mal mit seinem Bestand gespeichert.
So hat die EU-Kommission 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die die Frage klären soll, ob ein unionsweites Vermögensregister umsetzbar wäre, in dem Vermögenswerte ab 200.000 Euro erfasst würden. Die Analyse war mehrere Jahre in Arbeit. Im Juli 2024 berichtete die Wirtschaftswoche, die Veröffentlichung stehe kurz bevor. Sechs Tage später wurde die Studie auf einer EU-Homepage publiziert. Dabei war das Manuskript den Angaben im Dokument zufolge bereits im März fertiggestellt worden. „An die große Glocke hängen wollte die EU-Kommission die Veröffentlichung offensichtlich nicht“, mutmaßte die Zeitschrift. Laut einer EU-Sprecherin gebe es aber keine Pläne, eine Datenbank einzurichten. Ein paar Herbstprognosen weiter sieht das vielleicht schon anders aus.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und Business Insider erstellt.
Michael Höfling schreibt für WELT über Immobilien, Wirtschaftspolitik und Gold. Gemeinsam mit Michael Fabricius ist er für den Immobilien-Newsletter „Frage der Lage“ zuständig, den Sie hier abonnieren können.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke