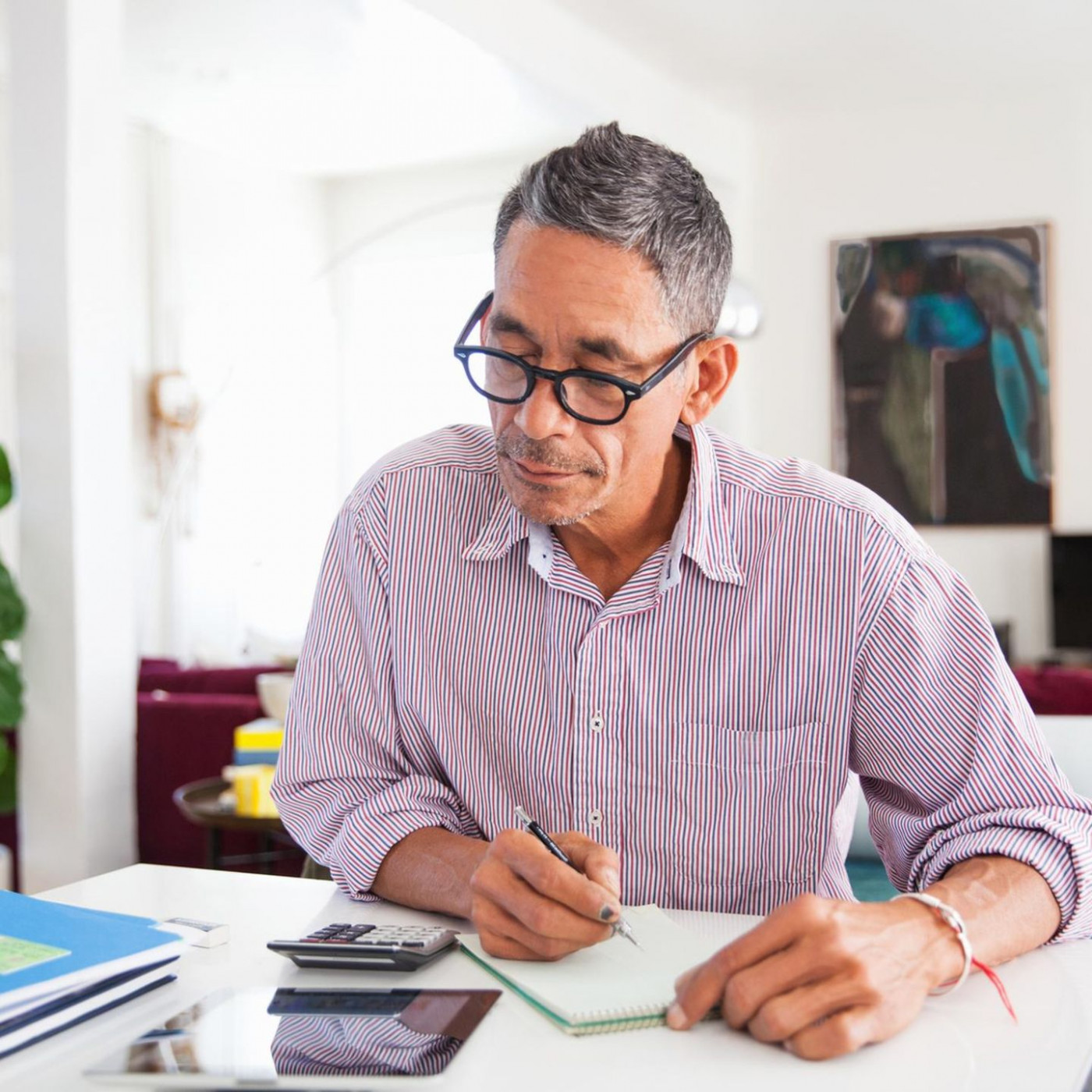Ein bisschen Hoffnung will sich die Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt nicht nehmen lassen. „Ohne Optimismus“, sagt Dorothee Bär (CSU), „hätte es das Wirtschaftswunder nie gegeben“. Dass Deutschland gerade erst in der Rangliste der weltweit innovativsten Länder auf den elften Platz abgerutscht ist, muss die Ministerin zwar auch zugeben. Doch der Standort sei immerhin „Comeback-erprobt“.
Dass Bär zu mehr Vertrauen aufruft, verwundert aber kaum: Wirtschaftliche Stagnation belastet die Unternehmen bereits seit drei Jahren, die Industrie gerät zunehmend unter Druck, viele erwarteten, heißt es auf dem Gipfel später von Civey, keine guten Zukunftsaussichten. Echte Lösungen? Bisher rar.
Auf dem Future Pioneers Summit von WELT, „Business Insider“ und „Politico“ ist das allerdings anders. Hier geht es darum, wie dieses „Comeback“, die Rückkehr zu wirtschaftlicher Stärke, gelingen soll. Der Impuls der Ministerin ist nur einer von vielen. Mehr als 100 Vertreter aus Unternehmen, Führungskräfte und Entscheider sind an diesem Donnerstag gekommen, um ihre Ideen gegen die Standort-Krise zu präsentieren. Das sind die 6 Lehren des Abends.
1. Veränderungen, aber nur langfristig
Einer von ihnen: Opel-Chef Florian Huettl. Seine Branche sei an Umbrüche gewöhnt, sagt er. Immer wieder habe sich gerade die Autoindustrie verändern müssen, so Huettl. Die Herausforderungen seien heute zwar größer als in den Jahren zuvor, noch gebe es aber „eine tiefe Stärke“ in der Industrie.
Dafür, sie einzusetzen, brauche es aber noch mehr politische Unterstützung. „Wenn ich heute in ein Batteriewerk investieren möchte, muss ich sicher sein, dass es zehn bis fünfzehn Jahre laufen kann“, sagt Huettl.
Das jedoch sei aktuell nicht der Fall, verhindert durch fehlende Berechenbarkeit bei den Regelungen und den Schlinger-Kurs zwischen den Regierungen. Huettls Beispiel: Ein Verbrenner-Aus bis 2035 sei zwar „nicht realistisch“, gleichzeitig einigte sich die Politik bisher nicht zuverlässig auf ein Ende des Vorhabens.
Stattdessen seien Autobauer gezwungen, durch zunehmende Regulierungen ihre Preise zu erhöhen. Huettl: „Innovationen, die wir uns vorgenommen haben, müssen wir immer wieder überprüfen“.
2. Besser dank Zurückhaltung
Widerspruch dazu kommt vom Mobilitäts-Gründer René Braun, der 2023 selbst den Future-Pioneers-Award bekam. Zu viel diskutiere die Industrie über das Verbrenner-Aus und mögliche Hürden, gleichzeitig „verschlafen wir die wichtigste Innovation“, so Braun: das autonome Fahren. Investoren hätten dafür in Deutschland eigentlich eine sehr vorteilhafte „Nähe zu Ingenieurstechnik“, die „so in den USA oder China nicht vorhanden ist.“
Ist Deutschland also zu zurückhaltend vor potenziellen Investoren? Paul Achleitner, zehn Jahre Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, heute selbst Investor und Standort-Deutschland-Experte, warnt vor zu offensiver Kommunikation. Ein zu großer Fokus auf Marketing und Öffentlichkeit, sagt er, könne davon ablenken, dass es eigentlich auf wesentlichere Dinge ankomme.
„Natürlich sind wir zurückhaltend, das muss aber nicht notwendigerweise schlecht sein“, sagt Achleitner. Viele Chefs erzählten heute eine „super Story“, die besten Ergebnisse könnten jedoch nur diejenigen erzielen, die wirklich auf wirtschaftliche Kennzahlen achteten.
Gerade in Deutschland würden aus seiner Sicht jetzt zwei Schlüsselfaktoren wichtig: Wachstum und Sicherheit. „Wir leben in einer Zeit der Superpowers“, sagt Achleitner, „daher braucht es für uns eine gemeinsame Marschrichtung.“
3. Chancen geben gegen den Fachkräftemangel
Dafür braucht es jedoch erst einmal das passende Personal. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) fehlen in Deutschland aktuell mehr als 530.000 Fachkräfte. Betriebe in fast allen anderen Wirtschaftszweigen suchen gerade dringend neue Mitarbeiter. Gleichzeitig passen die Bewerber aber oft nicht zu den Stellen – oder bleiben sogar aus. Laut einer Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) können aktuell 44 Prozent der Mitgliedsunternehmen offene Stellen nicht besetzen.
Die beste Strategie laut Olga Vos: „People-Business – vor und hinter der Theke“. Sie ist Franchise-Unternehmerin bei McDonald’s, verantwortet Restaurants in der Nähe von Hannover. Fachkräfte-Probleme erlebe sie dort allerdings nicht. Warum? Im Fast-Food-Business sei es üblich, dass „Menschen, die gerade drei Monate in Deutschland sind und jene, die gerade ihr BWL-Studium finanzieren“ gleichermaßen erst einmal eine Chance bekämen, sagt Vos.
4. Weiterarbeiten gegen die Rentenlücke
Es ist nicht das einzige Arbeitsmarkt-Problem. Gerade erst verständigte sich die Regierungskoalition aus CDU und SPD auf Reformen unter anderem bei der Rente. Künftig soll einfacher auch über das reguläre Eintrittsalter hinaus gearbeitet werden können, dann mit steuerbegünstigten Verdienstmöglichkeiten, so die Idee.
Wie das funktionieren könnte, zeigen an diesem Donnerstag die Fahrrad-Unternehmerin Susanne Puello. Die 64-Jährige dachte vor zwei Jahren noch selbst daran, vorzeitig in Rente zu gehen, kaufte dann aber stattdessen eine Firma zurück, die ihr Ende der 1990er-Jahre schon einmal gehörte. Heute leitet sie das Unternehmen zusammen mit ihrer Tochter. Man ergänze sich durch den Generationen-Austausch besser.
„Wenn die Jungen auf die Erfahrung der Alten setzen und die Älteren auf ihre Erfahrung etwa bei der Digitalisierung, kann das ein Zukunftsmodell sein, das wir brauchen“, so Puello. Es sei deshalb gut, dass wer gesund sei und sich fit fühle, in Zukunft bessere Rahmenbedingungen fürs Weiterarbeiten bekommen soll.
5. Wachsen statt Denken
WELT, Business Insider und Politico zeichnen auch deshalb erfahrene Manager mit dem Future-Pioneers-Award aus. Preisträger dieses Jahr: René Obermann, lange Chef der Telekom und heute Manager beim US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen Warburg Pincus.
Aus seiner Sicht wichtig: eine schnelle Umsetzung der Reformen. Nicht nur beim Weiterarbeiten, auch innerhalb der Unternehmen. „Wichtiger als Vordenken ist machen. Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt“, sagt er.
Das verdeutliche auch eine Entscheidung aus seiner eigenen Laufbahn: Während sein Bruder sich für eine Professoren-Karriere entschied, brach Obermann die Universität mit 23 Jahren ab. Entscheidend für Erfolg sei für ihn heute jedoch: Mit Menschen zu arbeiten, die zwar weitsichtig, aber auch umsetzungsstark sind.
6. Nach Überzeugung handeln
Neben dem etablierten Vordenker wurde auch ein Gründer mit Pioniergeist ausgezeichnet. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden drei von ihnen eingeladen, einen Pitch über ihre Idee zu halten. Die Zuschauer im Saal und am Stream entschieden per Voting über den Sieger. Zur Wahl standen Sozial-Unternehmer Till Wahnbaeck, IT-Gründerin Ina Remmers und Quantum-Computing-Unternehmer Jan Leisse.
Gewinner in diesem Jahr: Der Sozial-Unternehmer Till Wahnbaeck, der es schaffte, über einen „Finanzamt-Hack“ legal aus Spenden Beteiligungen an afrikanischen Start-ups zu machen.
Lehre des Unternehmers: „Wir haben eine große Lücke“, sagt Wahnbaeck, „zwischen extrem effizienten Unternehmen und Menschen, die wirklich etwas ändern wollen.“ Es brauche einen „kühlen Kopf und etwas, was einen wirklich berührt“, um erfolgreich zu werden.
Sein Wunsch an die Politik? Keiner. „Wir müssen aufhören ständig etwas von der Politik zu fordern. Wenn wir alle bei uns selbst anfangen, ist die Welt schon ein Stück weiter.“
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und „Business Insider Deutschland“ erstellt.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke