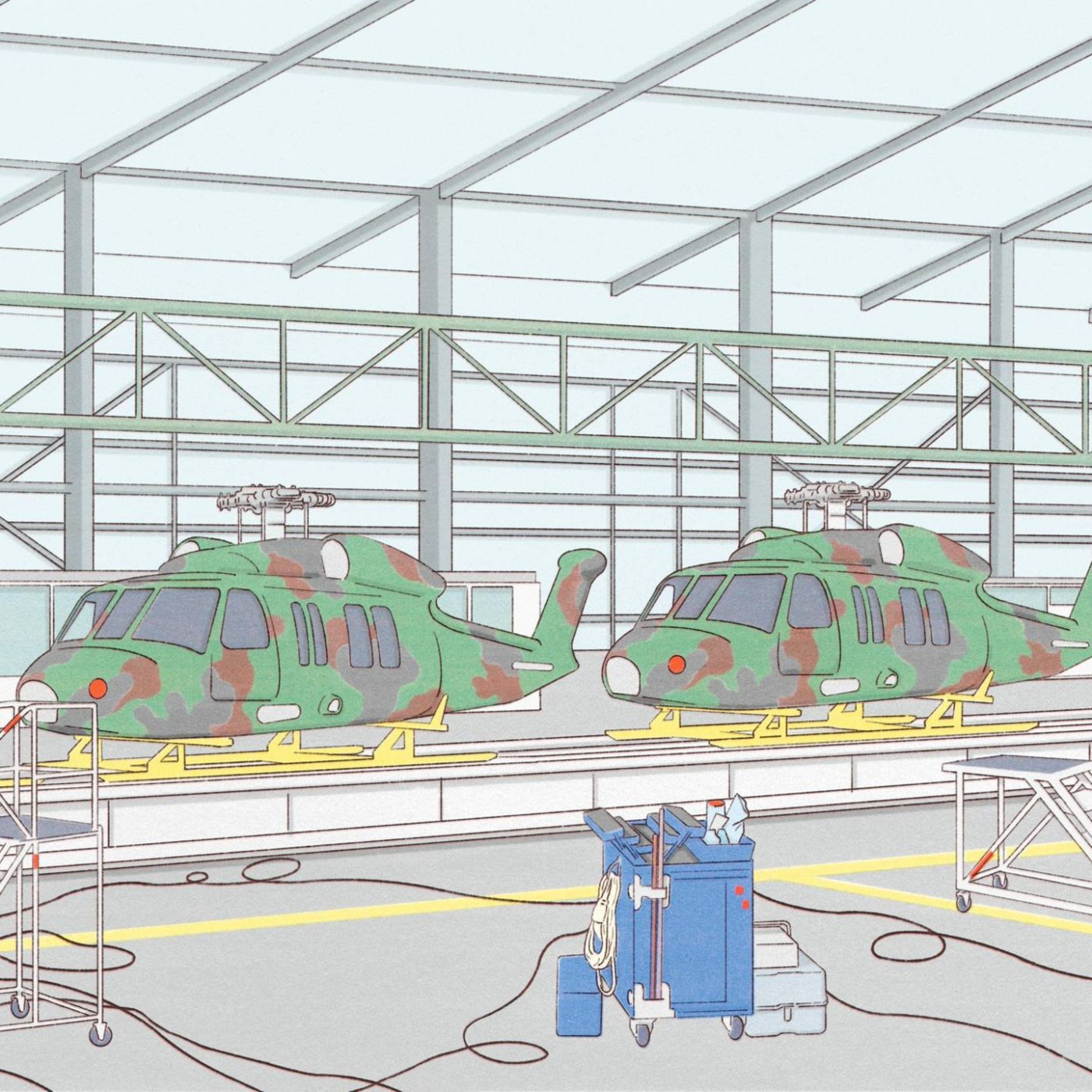Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im September wieder verschlechtert - nach einer Serie von sechs Anstiegen. Auch Forschungsinstitute erwarten nur ein Mini-Wachstum in diesem Jahr.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend erstmals seit einem halben Jahr verschlechtert. Das ifo-Geschäftsklima ist im September um 1,2 Punkte auf 87,7 Punkte gesunken, wie das Münchner Forschungsinstitut heute mitteilte. Es ist der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland.
"Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen. Analysten hatten hingegen eine bessere Stimmung in den Unternehmen erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg des ifo-Index auf 89,4 Punkte ausgegangen.
"Lethargisch wirkendes innenpolitisches Umfeld"
Die vom ifo-Institut befragten Unternehmen haben im September sowohl die aktuelle Lage als auch die Bewertung der künftigen Geschäfte schlechter eingeschätzt. Vor allem bei Dienstleistern habe sich das Geschäftsklima "merklich verschlechtert", hieß es. Der Indikator fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar. Im Bauhauptgewerbe sei der Index dagegen nach dem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen - vom Bau könnten also wieder Impulse kommen.
"Der Rückgang des ifo-Geschäftsklimas ist eine kalte Dusche", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Dass die Unternehmen weniger optimistisch in die Zukunft schauen, mag auch an der Enttäuschung darüber liegen, dass der erhoffte Neustart in der Wirtschaftspolitik wohl ausbleibt." Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei Hauck Aufhäuser Lampe, äußerte sich ähnlich: "Mal wieder werden Wachstumshoffnungen enttäuscht. Daran ist das lethargisch wirkende innenpolitische Umfeld nicht ganz unbeteiligt."
Krüger zufolge ist die aktuelle Geschäftslage so schlecht "wie zu Zeiten der Finanzkrise und Corona-Pandemie". Unternehmen seien noch dabei, sich auf die höheren US-Zölle einzustellen und Lieferketten zu ordnen. "Die große Herausforderung bleibt, mit der Fiskal-Bazooka dauerhaft einen höheren Wachstumspfad zu erreichen." Für einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) müsse das Geld tatsächlich in der Realwirtschaft ankommen, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Ein fester Anker bleiben derweil die Zinssenkungen der EZB", fügte er hinzu.
Institute sehen Reformbedarf
Die deutsche Wirtschaftsleistung war im zweiten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Auch die Aussichten für das Gesamtjahr sind schwach. So sagen die führenden Forschungsinstitute der deutschen Wirtschaft Insidern zufolge in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum voraus. Die Wirtschaftsleistung werde voraussichtlich um 0,2 Prozent zunehmen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.
Im nächsten Jahr sollte es dank mehr staatlicher Ausgaben aus dem Infrastrukturprogramm spürbar stärker bergauf gehen - mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und 2027 mit plus 1,4 Prozent. Die Ökonominnen und Ökonomen plädieren für massive Strukturreformen der schwarz-roten Koalition, um die Wirtschaft auch langfristig fit für die Zukunft zu machen, wie es hieß. So müsse das Produktionspotenzial erhöht und der Standort Deutschland wettbewerbsfähiger gemacht werden.
Im April hatten die Regierungsberater für dieses Jahr 0,1 Prozent Wachstum vorausgesagt und plus 1,3 Prozent für 2026. Die Institute legen der Bundesregierung ihr Herbstgutachten am Donnerstag vor. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose (GD) wird federführend erarbeitet vom Berliner DIW, dem Kieler IfW, dem Münchner ifo-Institut sowie dem Essener RWI und dem IWH aus Halle.
"Eine Art Germanosklerose"
IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller äußerte sich skeptisch: "Wir haben keinen normalen Aufschwung vor uns. Wir krebsen uns von unten an ein immer schwächer werdendes Produktionspotenzial heran." Das BIP je Einwohner sei fast drei Prozent niedriger als 2019, sagte der Ökonom aus Halle bei einer von der OECD organisierten Diskussionsrunde. Holtemöller äußerte sich nicht konkret zur Prognose der Institute, kündigte aber an, dass man der Regierung einen Zwölf-Punkte-Plan zu Strukturreformen vorlegen werde.
Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW, Michael Hüther, sprach mit Blick auf die wirtschaftliche Verfassung von "einer Art Germanosklerose": Deutschland stecke in einer Wachstumskrise, die strukturelle Gründe habe. Das über Jahre erfolgreiche Geschäftsmodell stehe unter Druck: Der Export leide unter Tendenzen der Deglobalisierung und des Protektionismus. Die Investitionen kämen nicht in Gang und die Konsumenten hätten angesichts steigender Arbeitslosenzahlen Sorgen um ihre Job-Sicherheit. "Das alles ist ein Strukturthema und da wird uns auch ein kurzes Konjunkturfeuerwerk nicht helfen."
Auch das von der OECD veranschlagte Wachstum von 1,1 Prozent für 2026 biete "keine Aufholqualität", so Hüther. Die Industriestaatenorganisation OECD prognostiziert, dass Deutschland nach zwei Rezessionsjahren in Folge 2025 nur mit einem leichten Wirtschaftswachstum rechnen könne. Die Konjunktur dürfte demnach um 0,3 Prozent zulegen. "In den europäischen Volkswirtschaften dürften die zunehmenden Handelskonflikte und die geopolitische Unsicherheit durch entspanntere Kreditbedingungen etwas ausgeglichen werden", heißt es in dem Konjunkturausblick.
Karsten Böhne, BR, tagesschau, 24.09.2025 12:04 UhrHaftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke