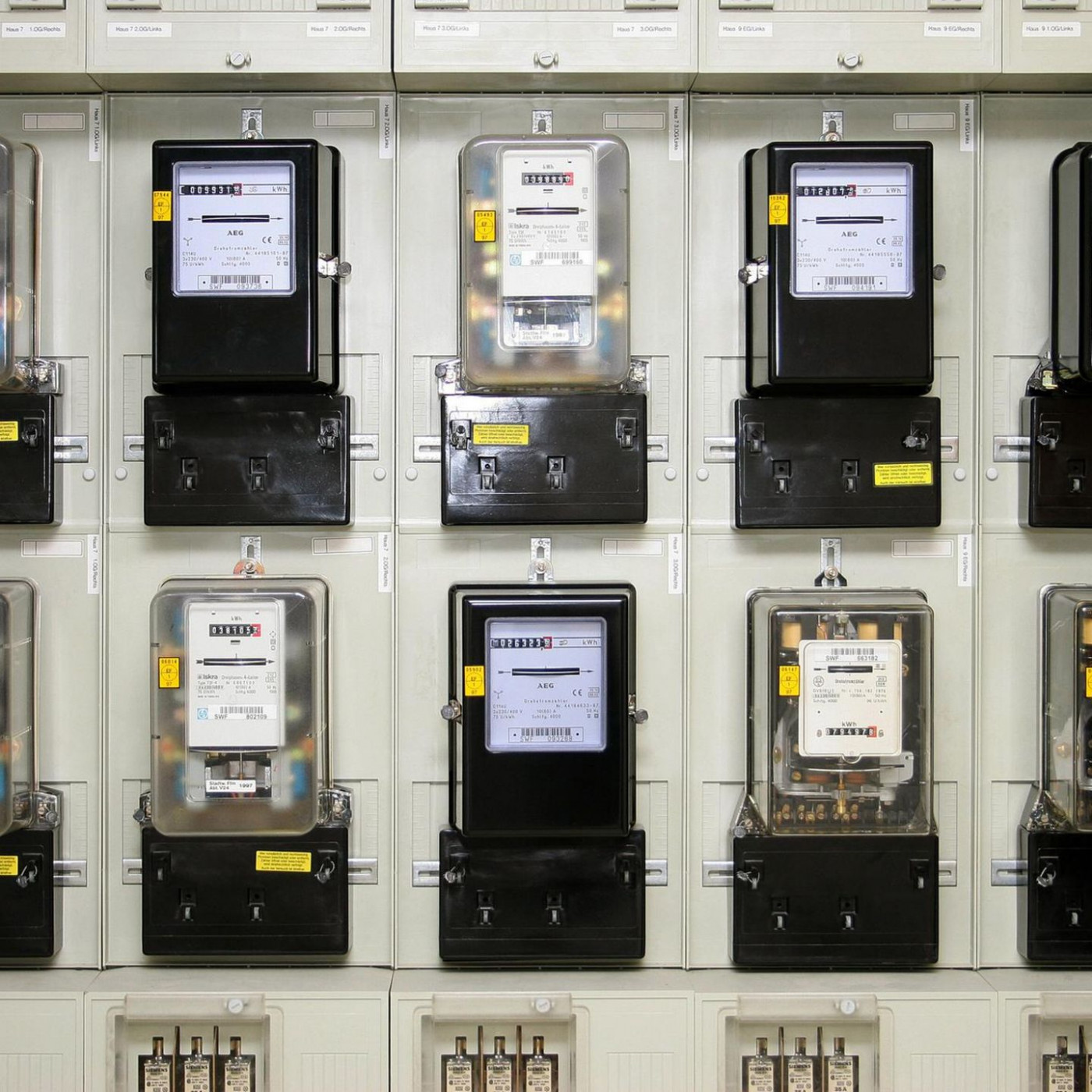Wie viel – oder besser gesagt wenig – Donald Trump von Jerome Powell hält, konnte man vor zwei Monaten auf der Baustelle der Zentralbank in Washington beobachten. Der amerikanische Präsident und der Chef der Notenbank Federal Reserve (FED) traten inmitten des Baustaubs vor die versammelte Presse. Statt Einigkeit jedoch ging es Trump um Konfrontation. Mit einem Papier wedelnd, provozierte er Powell: „Ihre Baustelle kostet jetzt 3,1 Milliarden Dollar mehr, das ist ja fast so teuer wie meine Kampagne.“
Powell, sichtlich erstaunt von Trumps Zahlen, konterte nach der Lektüre des Blattes: „Sie haben ein drittes Gebäude eingerechnet, das ist schon vor fünf Jahren fertig geworden.“ Trumps Showeinlage jedenfalls endete nicht wie geplant. Eigentlich wollte er vor laufenden Kameras demonstrieren, wie verschwenderisch die FED beim Umbau ihrer Zentrale haushaltet. Seinen Unmut auf Notenbank-Chef Powell, den der Präsident einst als „Vollidiot“ beschimpfte, dürfte das eher noch verstärkt haben.
Diese Vorgeschichte ist wichtig, will man verstehen, in welchem Spannungsfeld die FED gerade agiert. Denn knapp zwei Monate später hat Trump Powell dort, wo er ihn wollte – zumindest teilweise. Nach massivem Druck vonseiten der Regierung senkt die FED den Leitzins. Zwar bei Weitem nicht so sehr, wie Trump es sich vorgestellt hat. Aber immerhin um 0,25 Prozentpunkte – und erstmals seit Ende 2024.
Die US-Notenbank versucht damit, die Bremswirkung eines schwächelnden Arbeitsmarkts, steigender Preise und die Auswirkungen der Zollpolitik abzufedern. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 4 bis 4,25 Prozent. Während der Pressekonferenz in Washington, bei der Powell fast eine Stunde lang Fragen von Reportern beantwortete, wurde allerdings auch klar: Diese Entscheidung ist mehr als ein ökonomischer Routineeingriff – sie ist Teil eines Machtspiels zwischen dem Präsidenten und seinem obersten Notenbanker.
Donald Trump hatte keinen Hehl daraus gemacht, wie er sich die Geldpolitik vorstellt: niedrige Zinsen, billiges Geld und Wachstum durch steigenden Konsum. Da der US-Schuldenberg von derzeit rund 37 Billionen Dollar unter Trump noch rasanter zu wachsen droht als bisher, zielt der Präsident auf Entlastung über niedrigere Zinsen. Um gleich drei Prozentpunkte solle die FED den Leitzins senken, forderte er noch im Sommer.
Powell hingegen sieht sich der Unabhängigkeit verpflichtet. Doch die Realität zeigt, dass politischer Druck nicht folgenlos bleibt. Trump hatte im Vorfeld eine Senkung um mindestens 0,5 Prozentpunkte verlangt. Powell und seine FED-Kollegen setzten lediglich die schwächere Variante durch, wohl wissend, dass sie damit neuen Ärger aus dem Weißen Haus auf sich zu ziehen. Dass Powell während der Pressekonferenz Trumps Namen nicht ein einziges Mal erwähnte, dürfte dabei weniger Zurückhaltung als inszenierte Neutralität sein. Die Botschaft: Wir entscheiden nach Daten, nicht nach Tweets.
Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich schwach
In Wahrheit stellt sich aber längst die Frage: Wie frei kann die FED tatsächlich agieren? Ein Journalist sprach die Unabhängigkeit der Notenbank offen an, Powell jedoch wich aus: „Wir schauen optimistisch in die Zukunft“ – mehr wollte er dem Thema nicht hinzufügen. Ein Satz, der nach Beschwichtigung klingt, aber kaum Zweifel zerstreut.
Und die Lage dürfte sich in den nächsten Monaten kaum entspannen. Die US-Wirtschaft wächst zunächst zwar weiter, betonte Powell. Doch entscheidende Säulen schwächeln. Am Arbeitsmarkt ist von der Vollbeschäftigung, die Trump in Aussicht gestellt hatte, nicht mehr viel zu sehen. Die Arbeitsmarktzahlen waren zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem wurde das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis März 2025 um insgesamt 911.000 Jobs nach unten korrigiert – eine ungewöhnlich große Revision.
Nicht nur das ist kein gutes Zeichen für das langfristige Wirtschaftswachstum. Auch das Angebot an Arbeitskräften geht zurück – nicht zuletzt wegen der restriktiven Migrationspolitik, wie Powell mehrfach betonte. Aber auch die Nachfrage der Unternehmen nimmt ab: Firmen stellen vorsichtiger ein, Projekte werden verschoben, die Bereitschaft, neue Jobs zu schaffen, sinkt. Powell erwartet bis Ende des Jahres eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent – das wäre ein Anstieg um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem aktuellen Stand.
Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Vor allem Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs haben sich seit Trumps Amtsantritt im Januar spürbar verteuert – auch das ein gebrochenes Wahlkampfversprechen. Die Teuerung lastet als Konsequenz auf der Kaufkraft der Haushalte, droht so, die Konsumstimmung einzutrüben. Mögliche Preissprünge durch die Zölle sind darin noch gar nicht einberechnet.
Mit wiederholten Hinweisen auf „Unsicherheiten“ machte Powell deutlich, dass die größten Risiken aus seiner Sicht derzeit politischer Natur sind. Die restriktive Migrationspolitik mache sich negativ am Arbeitsmarkt bemerkbar. Und Trumps Handelspolitik mit neuen Zöllen sorge für unberechenbare Kosten. Er wolle das Ganze nicht politisch bewerten, so Powell – macht aber unmissverständlich klar: „Irgendjemand muss für die Zölle zahlen.“ Entweder seien es die Konsumenten an der Kasse oder die Unternehmen mit geringeren Margen.
An den Finanzmärkten wurde die Lage sofort eingepreist. Sowohl Börsen als auch Anleihemärkte reagierten kurzfristig positiv: Niedrige Zinsen bedeuten mehr Spielraum für Konsum. Und günstigere Kredite und niedrigere Hypothekenzinsen könnten bald schon Investitionen und Käufe ankurbeln. In diversen Anlegerforen wiederum lautet die Botschaft vor allem: „Jetzt Gold kaufen!“ Ein Reflex, der eher darauf hindeutet, dass das Vertrauen in langfristiges Wirtschaftswachstum abnimmt.
Das Wachstum sichern, die Inflation in den Griff bekommen und politischem Druck widerstehen – die Aufgabenliste für Powell ist mit der Entscheidung von Mittwoch eher noch komplexer geworden statt einfacher. Mit seinen fast einstündigen Verweisen auf Daten und Prognosen versuchte Amerikas oberster Notenbanker vor der versammelten Presse zwar die Deutungshoheit zu behalten. Doch der Druck aus dem Weißen Haus, den Leitzins weiter zu senken, dürfte kaum abreißen. Die nun beschlossene Senkung um 0,25 Prozentpunkte dürfte dem Präsidenten kaum genügen. Er will einen Leitzins von rund einem Prozent.
Der nächste Showdown zwischen Powell und Trump scheint bereits vorprogrammiert. Dass der Präsident den FED-Chef loswerden will, hat er längst offen eingestanden. Dabei hatte Trump selbst Powell 2018, in seiner ersten Amtszeit zum FED-Chef ernannt. Bis Mai 2026 läuft dessen Vertrag. Auf einen vorgezogenen Ruhestand scheint der 72-Jährige wenig Lust zu haben.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und „Business Insider Deutschland“ erstellt.
Jan Klauth ist US-Korrespondent mit Sitz in New York.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke