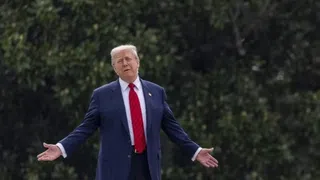Der Hälfte der US-Bevölkerung könne Tesla bis Jahresende Robotaxi-Fahrten anbieten – Zustimmung der Behörden vorausgesetzt. So tönte Elon Musk bei der Verkündung seiner jüngsten Quartalszahlen gewohnt großspurig. Genau genommen macht der Tesla-CEO im Bereich autonomes Fahren seit beinahe zehn Jahren Versprechen, die er dann nicht halten kann.
Erst seit Juni dieses Jahres rollen seine autonomen Teslas tatsächlich auf den Straßen von Austin in Texas. Währenddessen kommt Google-Tochter Waymo landesweit bereits auf 250.000 Robotaxi-Fahrten in der Woche und der chinesische Anbieter Baidu eigenen Angaben zufolge auf 1,4 Millionen Fahrten im Quartal. Doch obwohl die Hersteller öffentlichkeitswirksam das Zukunftsthema besetzen, ist die Frage, wer am Ende vom Milliardenmarkt profitiert, nicht endgültig geklärt – und im Windschatten rollen bereits Fahrdienstvermittler wie Uber und Lyft heran.
Der Gedanke dabei ist beinahe banal: Waymo, Tesla und Co. mögen technologische Pioniere in der Entwicklung sein. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass sie am Ende die Profiteure der neuen Technologie bleiben müssen. Denn auch Robotaxis werden vermutlich nicht ohne kluge Distribution auskommen. Elon Musk vertritt zwar beständig die Vision eines eigenen Tesla-Ökosystems, in dem man einerseits Taxidienste buchen, gleichzeitig aber als Tesla-Besitzer sein eigenes Auto zur Kurzzeit-Vermietung freigeben kann. Wann das kommt und ob die Wette am Ende aufgeht, ist offen.
Den Gegenentwurf liefern derweil die Fahrdienstvermittler, allen voran Uber. Deren Antwort auf den Robotaxi-Boom heißt ganz schlicht: Partnerschaften. In der Anfangsphase wollen sie dabei offenbar so diversifiziert wie möglich vorgehen. Mehr als 15 Partnerschaften hat Uber bereits eingetütet – zuletzt kamen prominente Namen wie Volkswagen und Baidu dazu. Waymo-Fahrten in den US-Städten Austin und Atlanta können Nutzer bereits seit diesem Jahr über die Uber-Plattform buchen. Der Fahrdienstvermittler hat sich dabei unterschiedliche Modelle überlegt, wie er seine Plattform monetarisieren kann.
Ubers Comeback im Robotaxi-Markt
Eines dieser Modelle beruht darauf, sich eine eigene Technologie zu sichern. Ganz auf Partnerschaften will Uber sich offenbar nicht verlassen: Als Investor beteiligt sich Uber mittlerweile direkt an Robotaxi-Entwicklern. So steckte das Unternehmen erst im Juli 300 Millionen US-Dollar in den Tesla-Konkurrenten Lucid sowie einen weiteren Millionenbetrag in das KI-Startup Nuro. Mit Nuros Technologie sollen Lucids E-Fahrzeuge Ende 2026 exklusiv für Uber auf die Straßen rollen. Mindestens 20.000 Fahrzeuge will Uber den Herstellern abnehmen.
Für Uber ist das ein Wiedereinstieg in den umkämpften Zukunftsmarkt. Ursprünglich hatte das Unternehmen unter Gründer Travis Kalanick eigene Forschungsambitionen für autonome Fahrzeuge – und investierte Milliarden in die Entwicklung der Zukunftstechnologie. Die Wende kam mit dem ersten tödlichen Unfall eines autonom gesteuerten Fahrzeuges im Jahr 2018. Nahezu ungebremst fuhr das Testfahrzeug im US-Bundesstaat Arizona damals in eine Fußgängerin. Nur zwei Jahre später verkaufte Uber seine Entwicklungssparte an das Startup Aurora.
CEO Dara Khosrowshahi begründete den Umschwung später auch mit einer simplen Frage des Geschäftsmodells: Uber habe entweder Plattformbetreiber werden oder ein Robotaxi-Vertical aufbauen können. Beides zugleich habe damals nicht funktioniert – zumal das Unternehmen zu dem Zeitpunkt noch Milliarden verbrannte.
Kaum eigene Autos – trotzdem Profiteur?
Mittlerweile hat Uber den Schritt in die Profitabilität geschafft. So verkündete der Konzern am Mittwoch, im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 12,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet und ein operatives Ergebnis von knapp 1,5 Milliarden Dollar erreicht zu haben – ein Plus von 18 bzw. 82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen übertraf damit die Erwartungen der Analysten.
Und: Uber ist als Plattformanbieter das, was man „asset light“ nennt. Fahrer und Autos sind im Gegensatz zu Taxi-Unternehmen ausgelagert. Demgegenüber zahlen Waymo-Mutter Alphabet und Tesla für die Entwicklung autonom fahrender Autos Milliarden. Zwar führt Alphabet die genauen Zahlen für Waymo nicht aus – in den Finanzberichten wird sie unter „Andere Wetten“ gelistet.
Und diese Sparte machte 2024 mehr als vier Milliarden Dollar Verlust. Die aktuell angebotenen Fahrten sind bislang nicht profitabel. Auch Tesla steht angesichts des schwächelnden Kerngeschäfts mit E-Autos vor Problemen – so sehr, dass sogar Elon Musk vor harten Quartalen warnte.
Partnerschaften sind für Uber also eine Möglichkeit, vom Robotaxi-Hype zu profitieren, ohne die hohen Entwicklungskosten tragen zu müssen. Gleichzeitig kann das Unternehmen so tech-affine Kunden auf der Plattform halten, die es sonst ins Ökosystem der Robotaxi-Anbieter verlieren würde. Und im Umkehrschluss bieten sie Baidu, Waymo und Co. eine Möglichkeit, ihre Geschäfte zu skalieren. Nämlich durch die rund 171 Millionen aktiven monatlichen Nutzer, die Uber 2024 auf seiner Plattform verzeichnete.
Uber-Konkurrent Lyft zieht nach
Dara Khosrowshahi erklärte am Mittwoch, dass Uber grundsätzlich drei verschiedene Modelle erprobe, während das Unternehmen das Marktpotenzial von Robotaxis mit seinen Partnern prüft. Eines davon ist ein sogenanntes Händlermodell, bei dem Uber seinen Partnern einen fixen Betrag pro Fahrt beziehungsweise pro Tag zahlt. „Wir tragen dabei das Risiko, unser Netzwerk zu monetarisieren“, so Khosrowshahi.
Als zweite Option führte der Uber-CEO eine Umsatzbeteiligung an, bei der Partner einen variablen Teil der Fahrtkosten bekommen – ähnlich wie Uber es aktuell mit seinen Fahrern handhabt. Zudem gibt es ein Lizenzmodell für die Software. Aktionäre hatten diesen Robotaxi-Fokus von Uber zuletzt grundsätzlich goutiert: Der Aktienkurs des Unternehmens war seit Jahresbeginn zeitweise um mehr als 40 Prozent gestiegen.
Entsprechend hatte sich auch Uber-Konkurrent Lyft stärker im Robotaxi-Markt positioniert – vor allem in Europa. So hatte Lyft mit der Übernahme von BMWs und Mercedes’ Joint Venture Freenow aufhorchen lassen. Erst vor wenigen Tagen folgte dann die Ankündigung einer Partnerschaft mit Baidu. Dessen Apollo Go Autos will Lyft nach Europa bringen, während sich Uber und Baidu zunächst auf Asien und den Mittleren Osten konzentrieren.
Das Beispiel zeigt aber: Auch die Hersteller erproben den Markt über verschiedene Partnerschaften. Waymo etwa kooperiert nur in Austin und Atlanta mit Uber. In anderen Städten buchen Kunden über die hauseigene App. Und mit Dallas kündigte Waymo erst vor wenigen Tagen einen weiteren Markteintritt an, bei dem das Unternehmen sich nicht auf Uber verlässt. Der Fahrtvermittler ist also noch stärker von Partnerschaften abhängig. Entsprechend rutschte der Aktienkurs von Uber zwischenzeitlich ab.
Khosrowshahi kommentierte die künftige Entwicklung der Waymo-Partnerschaft am Mittwoch zurückhaltend. Er erklärte lediglich, dass Uber Waymo-Taxis grundsätzlich gerne in mehr Städten auf der Plattform haben würde. Sie seien in Austin und Atlanta sehr gut ausgelastet. Allerdings blieb es bei diesen vagen Kommentaren – auch in der Vergangenheit war das Verhältnis der beiden Units nicht immer unproblematisch.
Wenn die Robotaxi-Wette aufgeht und Hersteller es tatsächlich schaffen, Kunden eine sichere Technologie anzubieten, ist Ubers aktuelles Geschäftsmodell gefährdet, das sich auf menschliche Fahrer verlässt. Vorausgesetzt, Robotaxi-Fahrten können menschliche Fahrer trotz teurer Technik beim Preis in Zukunft deutlich unterbieten. Für Uber steht also potenziell viel im Feuer.
Gleichzeitig bleibt es aktuell vollkommen offen, wer am Ende wirklich als Gewinner aus dem neuen Markt hervorgeht. Bleibt es nämlich bei der sich anbahnenden Aufgabenteilung aus Herstellern und Distributoren, könnten Anbieter wie Uber und Lyft sich von den Errungenschaften der Hersteller erst einmal mitziehen lassen, ohne selbst Milliarden-Investitionen tätigen zu müssen. Und am Ende trotz – oder gar wegen – der fehlenden eigenen Technologie oben aufschwimmen.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit „Business Insider Deutschland“.
Steffen Bosse ist Wirtschaftsredakteur und berichtet für WELT über alle Themen aus der Autoindustrie und der Beratungsbranche.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke