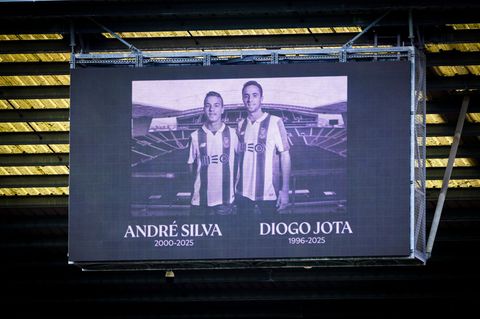In einer Schul-AG begann die Segel-Leidenschaft von Jochen Schümann. Der Berliner war begeisterter Bastler, und an der Schule im Stadtteil Köpenick bot sich 1965 die Gelegenheit, ein eigenes Boot zu bauen. „Ich liebe die Arbeit mit Holz“, erinnert sich der heute 71 Jahre alte Schümann. „Ab der fünften Klasse durfte ich an der AG ‚Bootsbau Segeln‘ teilnehmen.“ Im Sommer 1966 ließ er den Optimisten dann erstmals im Müggelsee zu Wasser. Kurz darauf wurde er bereits Berliner Meister in dieser Bootsklasse – der Startschuss für die Weltkarriere des erfolgreichsten deutschen Seglers.
Bald ging es in die Segelabteilung des Berliner TSC, doch an Olympia war zunächst nicht zu denken. „Der Zufall spielte eine große Rolle bei mir“, sagt Schümann. „Ich hatte 1972 das Glück, für das olympische Jugendlager nominiert zu werden. Da war ich sechs Wochen in München und Kiel, erlebte die Olympischen Spiele hautnah. Das war ein Traum und hat mir einen Riesenkick gegeben. Da wurde mir klar: Das willst du auch einmal als Sportler! Das war mein Schlüsselerlebnis.“
Den Schwung nutzte Schümann erfolgreich, um sich in der DDR gegen die etablierten Segler von der Ostsee durchzusetzen. Er war zweimal Junioren-Europameister. Das überzeugte die sportliche DDR-Führung. So durfte er 1976 als erst 22-Jähriger zu den Olympischen Spielen. In Kanada fuhr er im Finn-Dinghy auf dem Revier in Kingston (Ontariosee) fast der gesamten Konkurrenz weg. „Ich hatte nur Andrei Balashov aus der UdSSR als meinen ganz großen Gegner“, sagt Schümann. „Doch ich hielt ihn gut in Schach.“ Am 27. Juli wurde Schümann erstmals Olympiasieger.
Es folgten schwere Jahre: 1980 und 1984 gab es keine Medaillen für Schümann. Die beiden Olympia-Boykotte – erst vom Westen, dann vom Osten – hatten ihn erst Motivation gekostet, dann die Teilnahme als DDR-Segler für Los Angeles komplett verbaut. „Das waren harte Zeiten für mich“, sagt Schümann, der 1980 Fünfter wurde. „Es hat mich zur Verzweiflung und nahezu zum Aufhören getrieben. Wenn du dein ganzes Leben investierst, willst du natürlich bei Olympia segeln – und zwar gegen die Besten der Welt. Nicht nur so ein halbes Ding. Das bringt einfach keinen Sinn für den Aufwand, den man betreibt. Es war bei beiden Spielen eine tiefe Sinnkrise für mich und sorgte dafür, dass ich dort nicht so richtig gut war.“
„Die Wendezeit ab 1990 war schwierig“
Eigentlich hatte Schümann genug vom Segeln, doch dann ergab sich eine neue Perspektive. „Ich wollte 1984 Schluss machen“, sagt Schümann. „Doch die Trainer sagten: ,Versuche doch mal was anderes‘.“ Mit den beiden Berlinern Thomas Flach und Bernd Jäkel stieg er ins Soling-Boot um. „Wenn man vorher so lange Einzelsportler war, ist man natürlich auch viel allein mit sich“, sagt Schümann. „Das Team brachte eine andere Motivation und noch einmal viel mehr Spaß. Es war wohl die beste Zeit im Segeln, die ich hatte.“ Und sie war erfolgreich: 1988 holte das Trio in Südkorea gleich Olympiagold.
Dann folgte die deutsche Wiedervereinigung. „Die Wendezeit ab 1990 war schwierig“, sagt Schümann. „Alles wurde auf den Kopf gestellt, auch das alte Leistungssportsystem der DDR. Es war schwer, sich wiederzufinden.“ Vorher wurden Dinge wie Bootstransport und Finanzierung vom Staat organisiert. Wegen ihres Erfolgs fanden die drei Segler dann aber doch Arbeitgeber, die das Sportlerleben unterstützten und mittrugen, und so konnten sie weitermachen.
„Viele andere aus der DDR schmissen das Handtuch“, erinnert sich Schümann. „Bei uns war es 1992 eine Trotzreaktion, weil viele gesagt hatten: ,Schümann und Co. kannst du vergessen, die bekommen das nie auf die Reihe.‘ Da wollten wir zeigen, dass wir auch im gesamtdeutschen Team die Besten sind.“ Ein Trainingspartner war der heutige spanische König Felipe (57), der damals im Soling aktiv war.
1992 gab es in Barcelona allerdings nur Platz vier. „Das haben wir selber vergeigt“, sagt Schümann. „Wir waren amtierende Weltmeister, machten zu viele Fehler. Daher war der Ursprungsplan, nach 1992 aufzuhören, hinfällig.“ Statt Karriereende machte er weiter und holte 1996 in Savannah (USA/Georgia) sein drittes Olympia-Gold. Das Feld wurde dominiert: Im Halbfinale gegen Großbritannien und im Finale gegen Russland siegte das deutsche Boot jeweils 3:0. „Wir waren einfach die Besten“, sagt Schümann.
Olympia 2000 in Sydney beschäftigt ihn bis heute
Parallel zum olympischen Segeln orientierte sich Schümann ab 1992 auch Richtung America’s Cup. Daimler-Benz wollte mit der deutschen Kampagne „AeroSail“ beim größten Segler-Wettbewerb der Welt an den Start gehen.
Als Daimler dann aber 1995 nach dem Wechsel von Vorstandschef Edzard Reuter (†96) zu Jürgen Schrempp (81) ausstieg, sorgte das bei Schümann für viel Frust. Allerdings wurde sein Engagement im Ausland bemerkt. Das Schweizer Projekt „Fast 2000“ holte ihn. Problem: Es herrschte so viel Chaos, dass Schümann zur Frustbewältigung doch noch einmal Olympia 2000 in Sydney angriff. „Das waren böse Erfahrungen, aber auch eine große Lehrstunde für die späteren Cup-Kampagnen“, sagt Schümann.
Mit den neuen Vorschotern Gunnar Bahr und Ingo Borkowski startete er im Soling. Eigentlich war seine Crew am besten, doch eigene Fehler kosteten im Duell mit Dänemark Gold. „Da habe ich bis heute noch manchmal schlaflose Momente“, sagt Schümann. „Dann kommt hoch, was wir anders hätten machen müssen. Wir hätten gewinnen müssen.“
Alinghi: Der Beginn eines unglaublichen Projektes
Jetzt war endgültig Schluss mit Olympia. Noch bei den Spielen von Sydney wurde er vom Neuseeländer Russell Coutts in heimlichen Gesprächen bearbeitet: „Eigentlich hatte ich nach den ersten schlechten Cup-Erfahrungen die Nase voll gehabt und mir vorgenommen, das nie wieder zu machen. Aber Russell hat mich überzeugt.“
In einem Hotelzimmer in Genf wurde mit Teameigner Ernesto Bertarelli das Alinghi-Projekt auf einem weißen Blatt Papier entworfen. Also zog Schümann in die Schweiz und ging mit dem neuen Team ein eigentlich unglaubliches Projekt an. Innerhalb von drei Jahren wollte man den übermächtigen Titelverteidiger Neuseeland sowie die versammelte Weltelite schlagen.
Am Ende war Alinghi mit Coutts am Steuer und Schümann als Strategen so gut, dass die Mannschaft die Neuseeländer in deren Heimrevier im Hauraki Gulf vor Auckland mit 5:0 im Finale dominierte. „Wir haben Unmögliches möglich gemacht“, sagt Schümann. „Wir waren die Lernenden und haben einfach schneller gelernt. Es war ein großartiges Team, das sogar noch viel weiteres Potenzial hatte.“ Den Titel verteidigte die Schweizer Crew 2007 dann mit 5:2 gegen Neuseeland, vor Valencia, weil es in der Schweiz kein passendes Gewässer gab.
Als Schümann danach keinen neuen Vertrag bei Alinghi bekam, wechselte er als Teamchef kurzzeitig zum deutschen United Internet Team Germany. Die Kampagne wurde aber 2008 aufgelöst. So wurde er Skipper des französisch-deutschen ALL4ONE Challenge-Boots, das allerdings nicht an einem Cup teilnahm.
Schümann wurde 2024 nochmal Weltmeister
Bis heute ist Schümann immer noch eng mit dem Segeln verbunden. Dem deutschen Nachwuchs half er für den Youth- und Women’s America’s Cup bei der Sponsorensuche, ist Mentor. „Da habe ich Klinken geputzt“, sagt Schümann. „Das wirtschaftliche Umfeld für eine große Cup-Kampagne ist schwierig. Da müssten wir einen positiv Verrückten finden, der das angeht.“
Als Berater für ambitionierte Kapitäne ist er weiterhin sehr gefragt. So wurde er 2024 als Taktiker auf der Yacht „Olymp“ vor Palma de Mallorca sogar noch einmal Weltmeister in der ClubSwan50-Klasse – einem 16,74 Meter langen Boot mit Zwölfer-Crew. Dort unterstützte er den Eigner und Steuermann Mark Bezner, früher ein Leistungsschwimmer. „Gewinnen macht immer noch Spaß“, sagt Schümann. Auch bei der EM 2025 ging er mit an Bord – Platz drei in Scarlino/Italien.
„Das ist lukrativ und bereitet mir Freude, aber diese Projekte reduziere ich gerade langsam“, sagt Schümann. „Ich werde ja auch nicht jünger.“ So kommt er inzwischen auf etwas weniger als 50 Segel-Tage pro Jahr. „Ich segle noch zum Spaß auf dem Starnberger See“, erzählt der dreimalige Olympiasieger, der südlich von München in Penzberg lebt. „Das bleibt Leidenschaft.“
Ein eigenes Boot hat er aber nicht: „Das habe ich meiner Frau versprochen“, sagt der Olympiasieger. „Meine Ansprüche wären ans Boot zu hoch, und ich möchte mehr meiner Familie zur Verfügung stehen. Die hat über die Jahrzehnte schon genug Opfer gebracht“, ergänzt er lachend. „Ich brauche da kein Boot mehr, das ich als weiteres Familienmitglied betreue.“
Der Beitrag wurde für das Sport-Kompetenzcenter (WELT, „Bild“, „Sport Bild“) erstellt und zuerst in der „Sport Bild“ veröffentlicht.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke