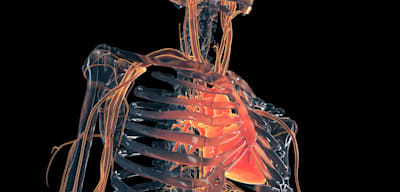Sie wiegen rund tausendmal so viel wie wir Menschen und leben oft mehr als doppelt so lange: Die außergewöhnliche Langlebigkeit von Grönlandwalen könnte einer Studie zufolge mit einer besonderen Fähigkeit zusammenhängen, Zellveränderungen zu reparieren und sich damit vor Erkrankungen zu schützen.
Dies beschreibt ein Team des Albert Einstein College of Medicine in New York im Fachblatt „Nature“ – und sieht in dieser Erkenntnis über die langlebigsten Säugetiere auch Potenzial für den Menschen.
Mit ihrem Gewicht von teils mehr als 80.000 Kilogramm und ihrer langen Lebensdauer von teils als 200 Jahren müssten die Tiere gemäß gängiger Annahmen eigentlich ein hohes Krebsrisiko haben, schreiben die Autoren um Jan Vijg und Vera Gorbunova – doch dies sei nicht der Fall. Das Phänomen, dass große Säugetiere seltener an Krebs erkranken, als es ihre besonders hohe Zahl von Körperzellen erwarten ließe, nennt man Petos Paradoxon.
Warum Grönlandwale dem Krebs trotzen
Das New Yorker Team hat bei Grönlandwalen die Wahrscheinlichkeit untersucht, dass sich Zellen der Wale unter krebserregenden Reizen wie etwa UV-Strahlen zu Krebszellen entwickeln. Sie verglichen dies mit Veränderungen in menschlichen Fibroblasten, also Zellen, die Bindegewebe bilden.
Das Ergebnis: Die Walzellen benötigten weniger Mutationen, um bösartige Tumore entstehen zu lassen. Allerdings wiesen die Zellen der Grönlandwale insgesamt weniger Mutationen auf als die menschlichen Zellen.
Dies erklären die Forscher damit, dass die Wale ihre DNA besonders erfolgreich reparieren. Analysen der Reparaturprozesse zeigten, dass bei bestimmten DNA-Schäden solche Reparaturen nicht nur häufiger stattfanden, sondern auch eine höhere Qualität hatten als beim Menschen.
Kooperation mit lokalen Gruppen
Das untersuchte Gewebe stammte von ausgewachsenen Grönlandwalen aus Alaska, die zwischen 2014 und 2021 von indigenen Gruppen zum eigenen Verzehr gejagt wurden. In Kooperation mit den lokalen Organisationen vor Ort konnten direkt nach dem Anlanden der Wale an der Küste Gewebeproben entnommen werden, die später analysiert wurden.
Dass Wale offenbar besonders erfolgreich veränderte Zellen reparieren, liefert aus Sicht des Forschungsteams Ansätze für die weitere Entwicklung von Krebstherapien bei Menschen. Derzeit gebe es keine zugelassenen Therapien, die darauf abzielen, die Reparatur von DNA zur Vorbeugung von Krebs oder altersbedingtem Verfall zu stärken, schreibt das Team.
Als eine Einschränkung führen die Wissenschaftler an, dass beim Vergleich zum Menschen Fibroblasten betrachtet wurden – und nicht sogenannte Epithelzellen, in denen die meisten Krebsarten entstünden.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke