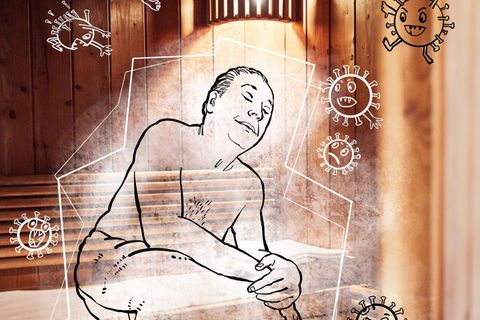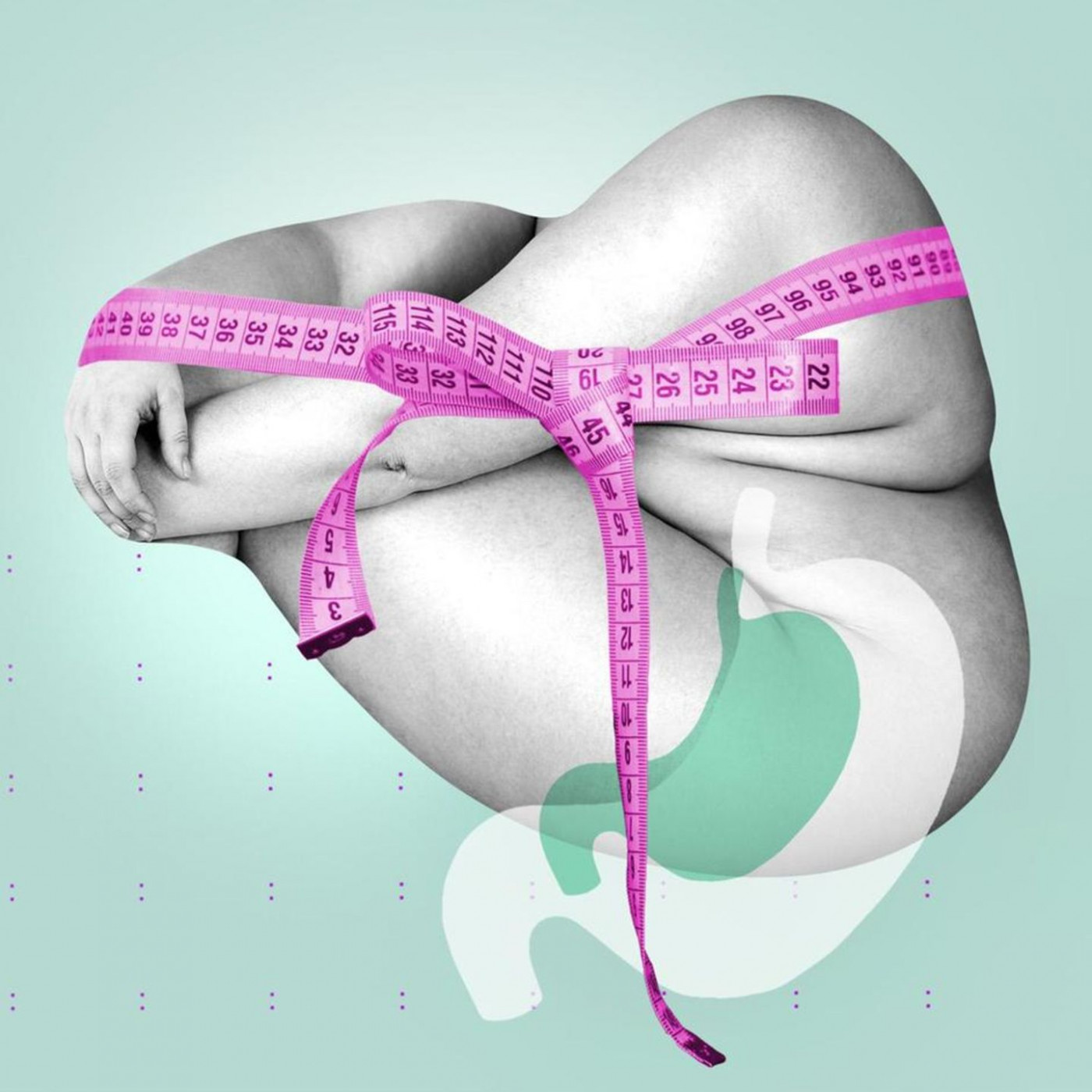Noch ist das H5N1-Influenzavirus in erster Linie für Vögel problematisch. Dieser Erreger der Vogelgrippe kann zwar bestimmte Säugetierarten befallen, aber Menschen haben sich meist nur unter besonderen Bedingungen infiziert. Dennoch befürchten Experten, dass geringfügige Mutationen das Virus zu einem gefährlichen Killer machen könnten.
Mitte Oktober hat daher ein neuer deutschlandweiter Forschungsverbund seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, Grippeviren, die von Tieren auf Menschen „überspringen“ können, frühzeitig zu identifizieren und ein mögliches Pandemierisiko abzuschätzen. An dem Projekt sind unter anderem das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit sowie die Universität Münster und die Berliner Charité beteiligt. Koordiniert wird es an der Universität Freiburg von dem Virologen Professor Martin Schwemmle.
Genetische Analysen, Tests zur Virusvermehrung sowie Untersuchungen zur Reaktion des menschlichen Immunsystems sollen die Basis schaffen, um das sogenannte zoonotische Potenzial bewerten und „im Ernstfall schnell reagieren“ zu können, so Schwemmle.
Das Risiko einer Ansteckung besteht hierzulande vor allem beim Einsammeln verendeter Wildvögel oder der Keulung infizierter Nutztiere. Diesem Personenkreis wird dringend empfohlen, Schutzkleidung sowie Handschuhe, Atemmaske und Schutzbrille zu tragen. Offensichtlich sind solche Vorsichtsmaßnahmen durchaus wirksam. Seit dem ersten H5N1-Ausbruch in Deutschland Anfang 2006 ist bislang kein Fall bekannt, in dem sich ein Mensch infizierte.
Weltweit dagegen kam es bereits zu mehr als 950 solcher Infektionen, und mehr als die Hälfte der Betroffenen starben: 1996 trat der Erreger in Südchina in Erscheinung, 1997 erkrankten erstmals Menschen – 18 in Hongkong, dann 2003 drei in China und drei in Vietnam, zwei Länder, die seither immer wieder betroffen sind; 2006 traf es auch Indonesien, 2015 vor allem Ägypten. 2024 zählten allein die USA 67 Fälle, und im ersten Halbjahr 2025 traten weltweit rund zwei Dutzend Fälle auf, von denen elf tödlich endeten.
H5N1-Virus hat sich verändert
Gefährlich wird es, wenn sich vermehrt Säugetiere, etwa Robben, Katzen oder wie in den USA Tausende Rinder infizieren. Das ermöglicht H5N1-Viren, sich an den Säugetierorganismus anzupassen. „So könnten Viren entstehen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko für den Menschen haben“, warnt Schwemmle.
Eine Gefahr ist auch, wenn Menschen mit H5N1 in Berührung kommen, die bereits mit klassischer Grippe infiziert sind. Die jeweiligen Erreger könnten ihr Erbgut so vermischen, dass Viren entstehen, die leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das wäre ein Worst-Case-Szenario, das Experten fürchten – als Ausgangspunkt einer raschen und weltweiten Ausbreitung.
Tatsächlich ist seit 2021 ein Wandel zu beobachten, es grassiert eine ganz neue Virusvariante. Die Vogelgrippe ist nun nicht mehr auf die Wintermonate beschränkt, sondern tritt ganzjährig auf, und H5N1 zieht in Wellen über Europa. Unter anderem waren Graureiher, Kormorane, Möwen und Seeschwalben betroffen, auch Greifvögel, Eulen und Störche. 2022 starben in der einzigen deutschen Basstölpel-Kolonie auf Helgoland die Hälfte der Altvögel und 90 Prozent der Jungen.
Derzeit trifft es vor allem Kraniche, deren Bestand sich gerade erst wieder erholt hatte. Tausende Wildvögel sind bereits verendet, rund eine halbe Million Nutztiere in Geflügelhaltungen mussten gekeult werden, um die weitere Verbreitung der Seuche einzudämmen.
Tiermedizinerin Ursula Höfle von der Universität Castilla-La Mancha in Spanien ist alarmiert: „Auf lange Sicht wird dieser Verlust von biologischer Vielfalt Konsequenzen haben, die schwer vorherzusagen sind.“ Das Virus hat inzwischen fast alle Kontinente erfasst, inklusive Antarktis, nur Ozeanien ist verschont. Ob und wann es zu einem neuen, für den Menschen gefährlichen Virus kommt, ist kaum seriös abzuschätzen. „Im Endeffekt ist es wie eine Lotterie“, meint Höfle.
Um dem Zufall nicht ausgeliefert zu sein, sollten sich Veterinäre, Geflügelbauern oder Jäger, die mit infizierten Tieren in Berührung kommen könnten, gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Beruhigend ist auch, dass in Europa mehrere Impfstoffe gegen H5N1 soweit entwickelt sind, dass sie im Falle einer drohenden Pandemie schnell zugelassen und produziert werden könnten.
Impfungen bei Geflügel gibt es unter anderem in China und Mexiko. In der EU darf seit 2023 unter strengen Auflagen gegen Vogelgrippe bei Tieren geimpft werden. Frankreich nutzt die Möglichkeit, um Enten vor dem H5N1-Virus zu schützen. In Deutschland sind diese Impfungen bislang nicht erlaubt.
Peter Hauk, Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg und derzeit Vorsitzender der Agrarministerkonferenz von Bund Ländern, mahnt zu Augenmaß und warnt vor Aktionismus. „Wir sind noch ganz am Anfang des Geschehens, die Vogelgrippe kann sich noch über Monate ziehen“, sagte Hauk WELT AM SONNTAG. Er appelliert an Geflügelhalter, wachsam zu sein, und sämtliche vom Tiergesundheitsrecht vorgeschriebenen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ihrer Ställe und Freilandhaltungen konsequent einzuhalten. Ein pauschale „Aufstallung“ des Geflügels – also das Einsperren in den Stall – hält er aus fachlicher Sicht und auch aus Tierschutzgründen für falsch. mit Science Media Center
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke