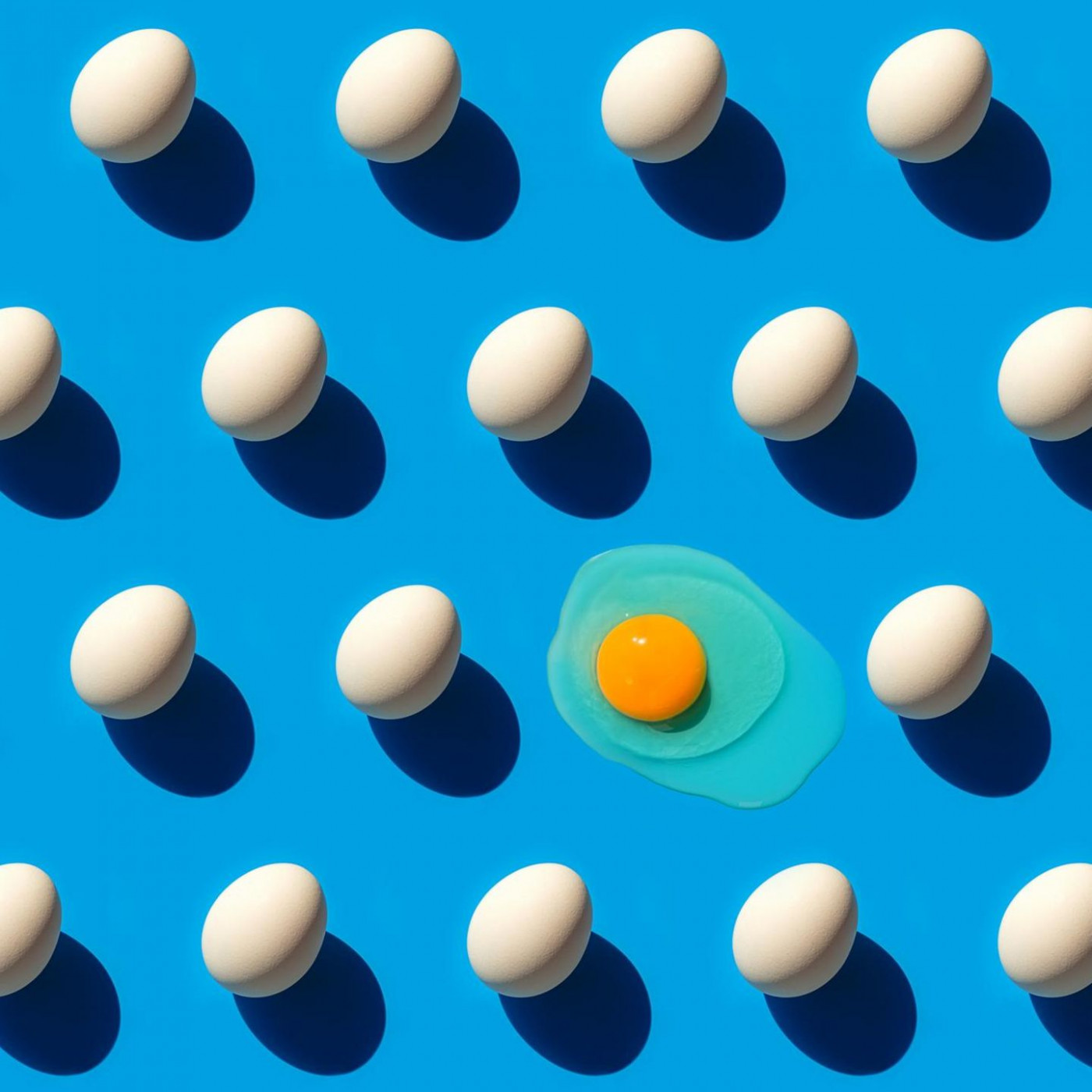Oh-oh-oh, uh-hu-huh-huh-huuuh-huuuuuh. Wenn Jane Goodall an ein Rednerpult trat, begann sie ihren Vortrag gelegentlich mit dem Ruf, mit dem sich Schimpansen in der Natur begrüßen. Immer intensiver wurden die Laute, bis das Mikrofon irgendwann übersteuerte. „Hier bin ich, wer noch?“, bedeutete das in der Sprache der Affen, wenn die am Morgen ihren Artgenossen zuriefen.
Es sind jene Töne, die Goodall selbst so oft gehört hatte in den Wäldern des Gombe-Nationalparks im Westen Tansanias, durch die sie so viele Male Tag für Tag gestreift war. Als junge Frau ging die damals 23-Jährige nach Afrika, lebte mehr als zwei Jahrzehnte lang unter wilden Schimpansen, nahm kaum vorstellbare Strapazen auf sich – und lieferte Erkenntnisse, die das Bild über unsere nächsten Verwandten für immer veränderten.
Jane Goodall war Pionierin und Naturschützerin, Forscherin und Friedensbotschafterin. Zusammen mit der US-Amerikanerin Diane Fossey hat sie die Primatologie revolutioniert. Die Engländerin schaffte es, sich gegen den Widerstand der männlich dominierten Wissenschaft und Gesellschaft durchzusetzen, sie verfolgte ihre Ziele, selbst gegen schier unüberwindbare Widerstände. „Wer das Unmögliche wagt, gibt nicht auf“, war ein Leben lang ihr Motto. Sie wurde weltberühmt, ein Popstar, und ein Vorbild vieler Mädchen und Frauen. Für viele wird sie das noch lange bleiben.
Es war dieser eine Moment in den frühen 1960er-Jahren irgendwo im tansanischen Gombe-Park, der einer der entscheidendsten dafür wurde. Sie war David Greybeard, wie sie einen der Schimpansen getauft hatte, stundenlang durch das Unterholz die Hügel hoch und runter gefolgt. Als sie glaubte, ihn aus den Augen verloren zu haben, hätte der Tag so enden können, wie so viele zuvor in den unendlichen Weiten des Regenwaldes.
Es war, als kommunizierten sie ohne Worte
Doch nie, schrieb sie später in ihren Memoiren, werde sie vergessen, was dann geschah: Am Ufer eines Bachs entdeckte sie ihn wieder, setzte sich neben ihn, schaute ihm in die Augen. Als sie eine der roten Ölpalmenfrüchte aufhob und sie ihm gab, nahm er zwar die Nuss, ließ sie jedoch fallen. Stattdessen griff er nach ihrer Hand, drückte sie sanft. Sie hatte sein Vertrauen gewonnen. Es war, als kommunizierten sie ohne Worte, in „einer Sprache aus einer gemeinsamen uralten Primatenvergangenheit“, notierte sie.
Diese Begegnung ließ nicht nur das Eis zwischen ihr und David Greybeard brechen. Sie brachte Goodall auch in dessen Gruppe aus rund 50 Artgenossen – und damit bald die Primatenforschung, gar das gesamte Selbstbild des Menschen durcheinander. Denn Greybeard war der Erste, dem Goodall dabei zusah, wie er von einem Zweig die Blätter abriss und mit dem Stock geschickt Termiten aus einem Hügel fischte, die er dann verspeiste. Eine vermeintlich unscheinbare Beobachtung. Doch sie wurde der erste Beleg dafür, dass Schimpansen und Menschen sich noch ähnlicher sind als gedacht: Auch Affen stellen gezielt Werkzeuge her und nutzen sie, um an Nahrung zu kommen. Als Goodall das Gesehene ihrem Mentor telegrafierte, dem Anthropologen Louis Leakey, soll der gesagt haben: „Dann müssen wir jetzt entweder den Menschen neu definieren oder den Werkzeugbegriff oder Schimpansen als Menschen akzeptieren.“
Bis dahin hatte die Wissenschaft geglaubt, zu solch technischen Leistungen sei allein der Mensch fähig, der Homo faber, der Werkzeugmacher. Zwar wusste man von Affen in Gefangenschaft, die Stöcke zusammensetzten, um an weit entfernte Bananen zu gelangen. Man war aber davon ausgegangen, die Tiere hätten das von ihren Pflegern gelernt. Mit den neuen Erkenntnissen hatte Homo sapiens sapiens ein weiteres Stück seiner vermeintlichen Einzigartigkeit verloren.
Die Wissenschaft – und auch die Theologie – war in Aufruhr. Große Teile hatten den Menschen für die Krone der Schöpfung gehalten. Einige Kritiker versuchten die Entdeckungen damit abzuwerten, dass die junge Britin keine entsprechende Ausbildung habe und damit keine zuverlässigen Informationen. Andere vermuteten, sie hätte den Schimpansen beigebracht, Werkzeuge zu benutzen.
Jane Goodall selbst bekam anfänglich nicht mit, wie sehr ihre Beobachtungen für Aufsehen sorgten. Sie setzte ihr Leben in der Abgeschiedenheit fort und begriff immer mehr, wie wenig beide Spezies wirklich voneinander unterscheidet. Genetisch sind es gerade einmal ein Prozent und auch emotional erschienen ihr beide Arten immer ähnlicher. Goodall gab den Schimpansen Namen, beschrieb ihre Persönlichkeiten, ihre Gefühle. Der streitlustige alte Mister McGregor, der traurige William, die scheue Olly, die elfenhafte Gilka, der kühne kämpferische Golliath und natürlich der ruhige, würdevolle David Greybeard.
Eine Vermenschlichung, die in der damaligen Verhaltensforschung verpönt war und es bis heute ist. Allein objektive Bezeichnungen und Beobachtungen gelten als seriös, Distanz zu bewahren als grundlegend. Goodall selbst sah ihre Unvoreingenommenheit hingegen als Gabe. Ermöglichte die ihr doch, den Tieren sehr nah zu kommen, physisch und psychisch. Sie lernte, dass auch Affen logisch denken und vorausplanen, sich küssen und umarmen, füreinander sorgen und komplex kommunizieren, enge Familien und Freundschaften bilden, nachtragend sind und auch mal eine Woche grollen.
Wie „in einem Paradies“ glaubte sie, die ersten zehn Jahre ihrer Forschung zu leben, schreibt sie in ihren Memoiren. Der Wald waren ihre Kathedralen, Schimpansen für bessere Wesen als die Menschen. Doch bei ihrer Rückkehr nach Tansania im Jahr 1965, nach ihrer Promotion in Cambridge, brach für sie dieses Bild brutal zusammen.
Sie und ihre Kollegen hatten Grausamkeiten unter den Schimpansen beobachtet, die sie nicht für möglich gehalten hatten, selbst in ihrer eigenen Gruppe: Mehrere Männchen waren über ein Weibchen hergefallen, hatten es zu Boden getrampelt, bis es später an seinen Verletzungen starb – das 18 Monate altes Junges hatte der Trupp ihr entrissen, es getötet und verspeist. Die Forscher sahen Weibchen, die Neugeborene aus der eigenen Gemeinschaft mit einem Biss in den Schädel ermordeten und auffraßen. Und Männchen, die gemeinsam auf Siegeszug gegen verfeindete Gruppen gingen, sie teils auslöschten, sogar mehrjährige Kriege gegeneinander führten. Goodalls vermeintlich heile Welt, die sie geglaubt hatte, unter den Tieren gefunden zu haben, entpuppte sich als raue Realität.
Wieder war die Wissenschaft aufgewühlt, Kollegen rieten ihr, die Daten nicht zu veröffentlichen. Die Befürchtung: Sie könnten dafür missbraucht werden, Gewalt beim Menschen als angeboren zu betrachten, Krieg als unvermeidlich. Es war Anfang der 1970er, die Zeit nach den beiden Weltkriegen und die des Kalten Krieges, in der viel über das Böse diskutiert wurde.
Goodall selbst wollte ihre Forschung weder in die eine, noch in die andere Richtung instrumentalisieren lassen. Sie wollte das Beobachtete so ehrlich wie möglich teilen, so unangenehm es auch sein mochte. Über ihre eigene Spezies kam sie zu einem Schluss, an dem sie bis zum Ende ihres Lebens festhielt: Es bringe nichts, abzustreiten, dass der Mensch mit einem Hang zu Gewalt geboren werde. Jeder Einzelne sei jedoch dafür verantwortlich, wie er mit dieser Neigung umgehe: „Ich glaube, dass wir die Fähigkeit haben, unsere aggressiven Instinkte zu kontrollieren.“
Jane Goodall wurde 1934 in London geboren. Von ihrem Vater, einem Autorennfahrer, der früh in den Krieg zieht, erbte sie die Abenteuerlust. Ihre Mutter bemerkte schon früh, wie sehr sich das Mädchen mit Tieren verbunden fühlt. Als Jane eineinhalb Jahre war, so erzählte sie es in ihrer Autobiografie, habe die Mutter sie mit einer Handvoll Regenwürmer im Bett entdeckt. Statt sie zu ermahnen, habe die nur gesagt: „Jane, sie werden sterben, wenn du sie hierlässt. Sie wollen in den Garten.“ Eiligst hätten sie die Würmer wieder zurück ins Freie gebracht. Später soll sie sich im Stall unter Stroh versteckt haben, um herauszufinden, wo aus einer Henne wohl das Ei herauskommt. Stundenlang, mucksmäuschenstill soll sie da verharrt haben, die Familie hatte sie bei der Polizei bereits als vermisst gemeldet.
„Wie wäre ich wohl geworden“, fragte sich Goodall in ihrem Buch, „wenn jedes Unternehmen durch eine strenge, unsinnige Disziplin im Keim erstickt worden wäre?“ Keineswegs sei sie ohne Regeln und Grenzen aufgewachsen. Immer aber sei ihr erklärt worden, warum manche Dinge verboten waren. Ihre Mutter war es auch, die sie lehrte, an sich selbst zu glauben: „Wenn du das wirklich willst, musst du hart arbeiten, jede Gelegenheit nutzen und nie aufgeben“, soll die zu ihr gesagt haben, als die Widerstände gegen ihre Afrika-Pläne zu groß schienen. Und als Goodall für ihre Zeit in Gombe vorschriftsmäßig eine Begleitung brauchte, war es ihre Mutter, die die ersten Monate mit ihr in der Wildnis verbrachte.
Voller Liebe zu Tieren und Natur
Trotz ihrer frühen Begeisterung für die Natur blieb Goodall ein späteres Studium versperrt. Als sie eine Einladung ihrer Freundin bekam, sie in Kenia zu besuchen, verdiente sie sich das Geld für die Reise als Sekretärin und Kellnerin. Vor Ort suchte sie den Briten Louis Leakey auf, einen der damals berühmtesten Paläoanthropologen überhaupt und Kurator am Nationalmuseum in Nairobi. Leakey hatte entscheidende Belege dafür gebracht, dass der Mensch in Afrika entstanden war. Aus dem Verhalten von Menschenaffen wollte er Rückschlüsse auf das der Frühmenschen ziehen. In der jungen Goodall sah er die beste Kandidatin dafür: unbefangen von vorherrschenden Vorstellungen in der Forschung, neugierig und geduldig, mutig und voller Liebe zu Tieren und Natur.
Sie selbst sah sich immer als „kleines Stückchen Treibholz“, das von einem „unfassbaren Wind stets auf einem bestimmten Kurs“ gehalten wurde, ob durch „sanften Druck oder heftige Stöße“. Schaue sie auf ihr Leben zurück, sehe sie die vielen Höhen, aber auch die Tiefen, darunter der frühe Krebstod ihres zweiten Mannes und die mehrmonatige Entführung vier ihrer Kolleginnen aus Gombe. Nie aber, schreibt sie, habe sie sich „wirklich verirrt“.
Auch ohne Studium gelang es ihr später mit einer Ausnahmegenehmigung zu promovieren. Bis an die Stanford University schaffte sie es später als Gastprofessorin. In Tansania gründete sie 1991 das Programm „Roots & Shoots“, das inzwischen in über hundert Ländern existiert und vor allem jungen Menschen die Natur näherbringen will. 2002 wird sie UN-Friedensbotschafterin, 2018 erscheint ein Film über ihr Leben. „Jane“ heißt er schlicht, so bekannt ist sie weltweit. Keiner anderen Biologin wurde bislang eine Barbie gewidmet, in Ranger-Outfit mit Notizbuch, Fernglas und ihrem liebsten Schimpansen Greybeard, der ein Werkzeug verwendet. Auch wenn sie selbst diese Puppe gehasst haben soll, wollte sie mit ihr ein Vorbild für Mädchen sein. Viele von ihnen wollen keine Filmstars werden, sondern wie sie ins Freie und die Tiere beobachten.
Dabei war Jane Goodall weit mehr als eine reine Naturliebhaberin. Sie hat gezeigt, was man erreichen, wie viel Einfluss man haben kann, wenn man für etwas brennt. Selbst als Frau im patriarchalischen England der 1930er, ohne Reichtum, ohne Uniabschluss. Selbst dann, wenn man sich Konventionen widersetzt und man Gegenwind bekommt, weil man Wahrheiten aufzeigt, so unangenehm sie auch sein mögen.
Bis ins hohe Alter sprach Jane Goodall auf unzähligen Bühnen, brachte ihre Botschaft in hunderte Länder, traf mindestens einmal monatlich in ihrem Podcast auf einflussreiche Persönlichkeiten und wurde als „globale Älteste“ gefeiert. Mit ihren zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren und dem noch immer neugierigen Blick setzte sie sich unermüdlich dafür ein, behutsamer mit der Umwelt umzugehen und die Schimpansen zu schützen. Deren Unterarten stehen allesamt auf der Roten Liste als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Um mehr als 80 Prozent ist allein die westliche Unterart in den letzten 20 Jahren geschrumpft.
In einem Punkt, so machte sie in vielen ihrer Auftritte klar, sind Affen doch besser als Menschen: Sie zerstören nicht ihren eigenen Lebensraum. Sie roden keine Wälder, verschmutzen keine Flüsse, rotten keine Tiere und Pflanzen aus.
Über den Tod selbst sagte sie einmal: „Also lasst uns die Welt wieder in Ordnung bringen, wenn wir im Moment des Todes sagen wollen, wir haben alles getan, was wir konnten.“
Jane Goodall starb am 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke