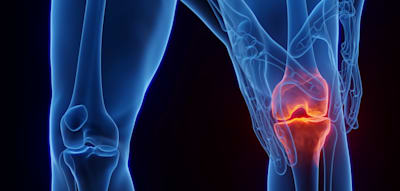August 2017. Schlafend liegt meine drei Tage alte Tochter neben mir im Bett. Ich schreibe die Geburtsanzeige und komme ins Stocken. Bei ihren großen Brüdern hatte ich die Ankündigung unseres neuen Familienstandes vollkommen selbstverständlich mit den Worten „gesund, glücklich und dankbar“ beendet. Das „gesund“ will mir dieses Mal irgendwie nicht aufs Papier. Etwas hemmt mich. Ich kann es nicht schreiben und es bleibt bei „glücklich und dankbar“. Mutterinstinkt.
Wie stark mein Gefühl recht behalten sollte, zeigt sich nur wenige Wochen später bei der standardmäßigen Vorsorgeuntersuchung U4. Das typische Neugeborenenschielen hatte sich bei Pauli nicht zurückgebildet. Im Gegenteil: Ihre Augen kullerten unkontrolliert in den Höhlen herum und statt uns anzusehen, huschten sie immer zum stärksten und somit hellsten Reiz.
„Lichthunger“ nennt man dieses Phänomen, wie ich nur kurze Zeit später lernen durfte, denn weder die Kinderärztin noch der dringend hinzugezogene Augenarzt gaben Entwarnung. Stattdessen fanden wir uns wenig später in der Uniklinik wieder, um Allerschlimmstes auszuschließen.
Denn der zikadenartigen Bewegung der Augen, auch Nystagmus genannt, können diverse Ursachen zugrunde liegen, vom Hirntumor bis zum Syndrom XYZ. Das Warten auf den Termin mit dieser schwammigen Ungewissheit über die scheinbar unendlichen Optionen an Schrecklichkeiten brachte mich um den Verstand. Wir haben unsere Kinder alle so bekommen, wie sie waren und verzichteten – bis auf die Standard-Ultraschalls – auf umfangreiche Pränataldiagnostik. Mein Mindset war dementsprechend im „Es komme, was wolle“-Modus. Aber so eine Ungewissheit war darin nicht vorgesehen – ein fieser Zustand.
Nach zahlreichen unangenehmen Untersuchungen endlich Entwarnung: „Sie ist nur blind“, sagte der Arzt zu uns. „Sie ist nur blind“, sagte ich zu meiner Schwester am Telefon. Ein Satz, von dem ich nie geglaubt hätte, dass er mir mit einem Gefühl der Erleichterung über die Lippen gehen kann und wird. Ein Satz, der in einem anderen Kontext durchaus das Potenzial hat, den Boden unter den elterlichen Füßen wegzureißen, löste in uns Dankbarkeit aus.
Kurz atmeten wir auf. Ein Gefühl wie beim Schaukeln: Erleichterung in dem Augenblick, in dem man ganz oben ist, gefolgt von dem unangenehmen Drücken in der Magengrube beim Zurückschwingen.
Die Fakten waren weiterhin recht schwammig. Ein Sehrest von unter zwei Prozent Sehkraft stand im Raum, eine kaputte Netzhaut, die Möglichkeit, dass es eine kleine Besserung gibt aber auch die Prognose des Gegenteils. Schlussendlich wurden wir mit dem Verdacht auf eine genetische degenerative Erkrankung der Netzhaut entlassen, der bei Spezialisten in der Uniklinik Tübingen bestätigt werden sollte.
Mit dem Durchsickern dieser Information tauchten unzählige Fragen auf:
Wird sie krabbeln?
Wird sie laufen?
Wird sie Fahrrad fahren?
Kann sie in einen ganz normalen Kindergarten gehen? Schule?
Was bedeutet das für unsere Familie? Die Geschwister? Unseren Wohnraum?
Wie viel kann sie sehen? Wie viel wird sie sehen können?
Wird sie eines Morgens aufwachen und alles ist schwarz?
Wie bereitet man ein Kind auf so etwas vor und sollte man das überhaupt?
Tief im Inneren, verborgen unter all dem Pragmatismus, schlummerten die großen Kaliber: Wird sie sich verlieben, so wie andere? Wird sie, nach einer durchfeierten Nacht, morgens auf dem Hamburger Fischmarkt auf einer Mauer sitzen und mit ihrem Schwarm knutschen? Wie verliebt man sich, wenn man nichts sehen kann? Wie vertraut man? Wie kann man unabhängig sein, ein selbstständiges Leben führen?
Während wir auf Termine und genetische Untersuchungsergebnisse warten, bekommen wir Antworten auf viele dieser Fragen. Der Hamburger Verein „Freunde sehbehinderter und blinder Kinder e.V.“, der Familien in diesen Situationen unterstützt, sorgte fortan nicht nur für die wöchentliche Frühförderung von Pauli durch eine liebevolle Therapeutin, sondern veranstaltet regelmäßig Familienwochenenden. Dort, in einem Schullandheim in Cuxhaven, lernen wir andere Familien mit sehbehinderten Kindern kennen, können uns austauschen und voneinander lernen. Und wir treffen blinde und sehbehinderte Erwachsene, die ihre Erfahrungen teilen. Ski fahrende, verliebte, studierende, Familie gründende blinde Menschen, die ein erfülltes, unabhängiges und glückliches Leben führen.
Diese Erfahrung gab uns nicht nur Hoffnung, sie erlaubte uns über den Tellerrand zu schauen, unseren Horizont zu erweitern und festzustellen, dass es so viel mehr gibt als diesen einen Sinn. Auch Paulis große Brüder profitieren von den Treffen: Neben Spiel und Spaß mit anderen Kindern nehmen sie an Selbsterfahrungserlebnissen teil. Neugierig und unvoreingenommen versuchen sie, mit verbundenen Augen zu essen, sich zu orientieren, und probieren Brillen auf, die das Sehen mit Einschränkungen imitieren.
Bevor wir wussten, wie viel Pauli wirklich sieht, versuchte ich den Jungs den Zustand ihrer Schwester anhand des Hais zu erklären. Haie verfügen über einen Sinn, der es ihnen ermöglicht elektrische Felder in der Umgebung wahrzunehmen. Wir Menschen nicht. Kann man etwas vermissen, von dem man gar nicht weiß, dass es existiert geschweige denn, wie es sich anfühlt?
Paulis Augen entwickelten sich im Laufe der Jahre noch ein bisschen weiter. Seit einiger Zeit bleibt ihr Befund stabil bei ca. sieben Prozent Sehkraft. Der Anfangsverdacht bestätigte sich: Pauli hatte im genetischen Roulette der seltenen Erkrankungen gewonnen. Eine degenerative Erkrankung der Netzhaut und die Einschätzung der Ärzte, dass sie ihren Sehrest im Laufe ihres Lebens komplett verlieren wird.
Schwarz auf weiß lese ich die Diagnose, die sich im Arztbrief immer drastischer darstellt als in der Realität. Dort sehe ich ein ausgeglichenes, fröhliches, selbstbewusstes und mutiges Mädchen, das uns täglich aufs Neue zeigt, wie man das Leben zu leben hat: voller Zuversicht, egal welche Steine einem in den Weg gelegt werden.
Dennoch wurde mit dieser Diagnose ein Aspekt tiefer in unser Leben gepflanzt, der zwar jeden Menschen ständig begleitet, den wir aber oft versuchen zu beherrschen: die Ungewissheit. Diese radikale Ungewissheit, die so eine Diagnose und Prognose mit sich bringt, zwingt einen auf die harte Tour dazu, sie zu akzeptieren. Das Unlenkbare. Das nicht Planbare. Und plötzlich merkt man, wie lächerlich es war, wissen zu wollen, was passieren wird, zu denken, man könnte dahinterkommen, hinter das Geheimnis des Lebens. Ich finde es nicht toll, dass Paulis Leben von einer Behinderung geprägt sein wird. Aber ohne sie hätten wir vielleicht den Blick nicht abwenden können von den Unwichtigkeiten des modernen Lebens.
Wir verwandelten diese Herausforderung in eine Chance, sagten uns, „wann, wenn nicht jetzt“, schnappten unsere drei Kinder, drückten auf Pause und machten ein Sabbatjahr mit Weltreise.
„Um ihr die Welt zu zeigen, bevor es möglicherweise zu spät ist“ höre ich mich unseren radikalen Schritt rechtfertigen.
„Sie machen das genau richtig“, antwortete Paulis Arzt, Professor an der Uniklinik Hamburg Eppendorf, auf den Bericht unseres Vorhabens, „ballern Sie sie mit so vielen Reizen zu, wie es geht. Irgendwann wird sie darauf zurückgreifen können und müssen – dann wird sie ihnen dankbar sein, und sie sich auch!“
Nach einem Jahr Weltreise und einem sich daran anschließenden einjährigen Besuch der Vorschule einer internationalen Schule auf Bali besucht Pauli heute als Inklusionskind die erste Klasse einer Hamburger Grundschule. Sie malt Bilder aus, spielt Klavier, klettert auf jedes Spielgerät, was ihren Weg kreuzt und fährt sogar Fahrrad, auf leeren Wegen, nicht im Straßenverkehr. In der Schule benutzt sie ein digitales Lesegerät, das alles, was man unter die integrierte Kamera legt, vergrößert auf einem Bildschirm abbildet.
Alles, was über ungefähr drei Meter hinaus geht, sieht sie stark verschwommen, und ihr Gesichtsfeld ist extrem eingeschränkt. Mimik anderer Menschen nimmt Pauli kaum wahr, wenn sie mit uns spricht, schaut sie uns nicht ins Gesicht, sondern horcht genau hin, während ihre Augen immer noch zum stärksten Reiz wandern. Dafür hat sie die feinsten Antennen und spürt jede Stimmung sofort. Hautkontakt ist ihre Energietankstelle und ihr Wortschatz ist um einiges größer als der gleichaltriger Kinder.
Nachtblind ist sie jetzt schon. Sobald es dämmert oder ein Raum zu wenig beleuchtet ist, sieht sie gar nichts mehr. Dann benutzt sie einen Langstock und lernt, sich damit zu orientieren. Ein Vorgeschmack auf das, was sie in ihrem Leben irgendwann erwarten wird? Möglich, aber sicher wissen wir es nicht.
Nachzulesen ist die Geschichte in Josefine Gaucks Buch „Mal gucken“ (Malik Verlag, 18 Euro).
Lebersche kongenitale Amaurose (LCA)
LCA ist eine seltene erbliche Netzhauterkrankung, die von Geburt an schwere Sehschwäche oder Blindheit verursacht. Die Häufigkeit beträgt 2 bis 3 Fällen pro 100.000 Neugeborene. Typische Anzeichen: fehlende Reaktion auf visuelle Reize, Lichtempfindlichkeit oder Augenreiben. Als Ursache gilt eine Mutation der Gene, die für den Aufbau und Funktion der Photorezeptoren in der Netzhaut notwendig sind. Es sind bisher 25 Gene bekannt, die mutieren können. Lange galt LCA als unheilbar. Aktuell gibt es Therapien für zwei Genmutationvarianten, um den degenerativen Prozess aufzuhalten.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke