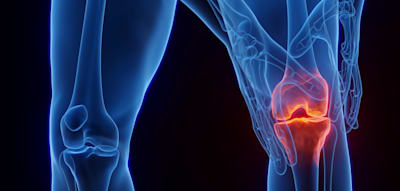Dem Nachbarn in Wien vertraute er sich zum ersten Mal an. Er habe Angst, verrückt zu werden - weil in der Familie so viele an psychischen Störungen erkrankt waren. Der Nachbar lachte nur. Die beiden zeichneten einen Stammbaum und überschlugen die Wahrscheinlichkeiten.
„Schizophrenie? Sucht? Depression? Bipolare Störung? Mein Stammbaum ist befallen von so ziemlich jeder Plage, die in den Bibeln der Psychiatrie zu finden ist. In wessen Fußstapfen soll ich treten? Welche verirrte Linie weiterführen?“
Der Großvater: Ein Kellner, der dem Wahnsinn verfiel
Der Ich-Erzähler wird im Roman Botanik des Wahnsinns ein einziges Mal mit Vornamen benannt: Leon. So wie der Autor. Es gibt mehr Übereinstimmungen. Beide haben rote Haare. Beide wachsen in München auf. Beide leben und studieren später die selben Fächer in Wien, dem Geburtsort des Großvaters – ein Kellner, der seine letzten Lebensjahre obdachlos verbrachte und immer wieder in die Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke „Am Steinhof“ eingewiesen wurde, Diagnose Schizophrenie.
Beide entdecken die Geschichte dieses Großvaters auf der Suche nach den Wurzeln psychischer Leiden in ihren Familien – Familien, die der Arbeiterklasse entstammen. Sie „haben keine Geschichte, keine Tradition, keine mündlich überlieferten Legenden“. Beide sind in ihrem Innersten angetrieben davon, die Verstorbenen dieser Geschichtslosigkeit zu entreißen.

Autor Thomas Melle "Der Kraftakt besteht darin, weiterzuleben"
Ja, vielleicht ist dieses beeindruckende Romandebüt tatsächlich eine „aus dem Ruder geratene Familienanamnese“, wie es im Klappentext heißt, und eine berechtigte Frage ist: Die des Autors oder die des Erzählers?
Familienanamnese: Menschen werden auf das Krankhafte reduziert
Die Familienanamnese, das ist ein Feld auf dem Patienten-Aufnahmebogen in psychiatrischen Kliniken, in das ein paar Zeilen Text über die psychischen Störungen der Mütter, Väter und sonstiger Verwandter passen. Verschwiegen wird, was diese Menschen wirklich ausmachte, wen sie liebten, was sie auszeichnete, welche Erfolge sie gefeiert und woran sie gescheitert sind. Die Menschen werden auf das Krankhafte reduziert.
Der Ich-Erzähler, der sich – so wie der Autor – nach einem Psychologiestudium für den Beruf des Psychotherapeuten entscheidet, hat damit ein Problem. Was solle er bei Familienanamnese eintragen, fragt er die leitende Psychologin des psychiatrischen Landeskrankenhauses schon an seinem ersten Arbeitstag: „Die ganze Familiengeschichte? Oder nur die psychischen Erkrankungen?“ Sie sagt nur: „Das schaffst du schon.“
Psychiatrie: "Das Ziel ist nicht, dass Menschen glücklich werden"
Der fiktive Leon will seine eigene Familienanamnese aufschreiben, während er lernt, psychiatrische Krankheiten zu diagnostizieren und zu therapieren. Die leitende Psychologin, bald auch seine Mentorin, gibt ihm immer wieder Ratschläge, Sätze mit dem Vorschlaghammer, die in Erinnerung bleiben.
Neun Sätze, die man Menschen mit Depressionen nicht sagen sollte

Was Dr. Jähne, Psychiater, dazu sagt: "Genau das kann der Patient nicht, er kann nicht aus diesem negativen Denken ausscheren. Da liegt auch der Unterschied zwischen einer Traurigkeit und einer Depression. Bei der Depression ist man über diese Schwelle hinaus, wo man positive Emotionen nicht mehr wahrnehmen kann, und dafür negative – wie Angst oder Ärger – viel, viel stärker." © Getty Images
Für die tobenden oder suizidgefährdeten Patienten auf der Geschlossenen: Man könne eh nichts verändern, nur die Veränderung begleiten. „Und häng die Latte hier nicht zu hoch. Das Ziel ist nicht, dass Menschen glücklich werden. Das bin ich auch nicht.“ Für die Patienten auf der Depressionsstation: „Versuche nie, sie aufzuheitern.“ Was man stattdessen tun solle, will Leon wissen: „Frage, wie es noch schlimmer werden kann.“ Oder für die Patienten auf der Suchtstation: „Das Trinken ist nicht das Problem, sondern die Zwischenlösung.“
Als der Erzähler ein Jahr später das Krankenhaus verlässt, ist er nicht fertig mit seiner Familienanamnese. Ihn treiben immer noch die gleichen Fragen um: Warum zum Beispiel wurde die eigene Mutter nach einer steilen Erfolgskarriere schwer depressiv und trank täglich literweise Wein – obwohl sie alles versucht hatte, um anders zu werden als ihre Mutter, Leons Großmutter, die schon in jungen Jahren in tiefer Traurigkeit versank? Die Mutter setzte ihrem möglichen Schicksal einen „orthodoxen Optimismus“ entgegen. „Sie lachte, strahlte und vertraute allen Menschen.“ Doch irgendwann wurde sie ihres Erfolges überdrüssig – und begann zu saufen. Leon kommt eine Erklärung des zu diesem Zeitpunkt längst verstorbenen Wiener Nachbarn in den Sinn: „Sobald die Leute genug haben, wovon sie leben können, stellt sich heraus, dass sie nicht wissen, wofür sie leben.“
Doch genügt das zum Verstehen? Im stern-Interview spricht der Autor Leon Engler vom „intrafamiliären Wiederholungszwang“ – ein Fachbegriff aus der Familientherapie. Heute könnte man wunderbar darüber spekulieren, woher dieser mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesene, schicksalhafte Hang mancher Menschen kommt, sich auf den von Ahnen geebneten Weg ins Unglück zu begeben. Hat es mit dem Erziehungsstil oder Umgang miteinander in den Familien zu tun? Oder vielleicht mit dem Aktivierungszustand von Genen? Auch unsere Erbanlagen können durch Traumata beeinflusst werden, so die Erkenntnis der Epigenetik.
Mittelalter: Als Wahnsinnige an Ketten gelegt wurden
Fachbegriffe wie diesen gibt es im Roman nicht. „Ich werde das in einem Sachbuch diskutieren“, sagt Engler. Als er vor fünf Jahren mit dem Schreiben begann, war bald klar, es würde zwei Bücher geben. Aus dem Roman habe er dann seitenweise Erklärabsätze gestrichen. Es ist aber genug übrig geblieben: Zahlreiche namhafte Psychotherapeuten, Schriftstellerinnen und Philosophen werden zitiert, es gibt Exkurse in Psychiatriegeschichte und ins Mittelalter, als die „Ver-rückten“ an Ketten gelegt und in „Tollkisten“ oder „Narrenhäuslein“ gesperrt an den Stadttoren ausgestellt wurden.

Psychiatrie Wege aus dem Wahn: Wie Patienten mit Schizophrenie geholfen wird
Bleibt die Frage: Was ist wirklich passiert, wo beginnt die Fiktion? Die Geschichte seines Großvaters habe er so gut wie möglich rekonstruiert, sagt Engler. Sogar dessen Krankenakte habe er nach langer Suche im Wiener Landesarchiv gefunden und wörtlich daraus zitiert.
Doch Engler, tiefblaue Augen, fester Blick, markantes Gesicht, ist ein anderer als der fragile, von Zweifeln und Einsamkeit geplagte Erzähler. „Im Gegensatz zu ihm schätze ich mich als sehr resilient ein“. Wir spazieren an einem Spätsommertag durch den Münchner Stadtteil Au, wo eine Großmutter Englers in einem Herbergshäuschen aufwuchs und später depressiv wurde. Doch schon sie weicht stark von der Romanfigur ab, und Engler wohnte auch nie unter einem Dach mit ihr. Sein alter ego trieb die Furcht um, „dass ihr Wahnsinn auf mich überpringen könnte“ – solche Ängste hatte Engler nie.
Der Roman: Grenzgang zwischen Fiktion und Autofiktion
Doch warum fließt so viel aus der eigenen Geschichte in diesen Roman? „Mich reizt dieser Grenzgang zwischen Fiktion und Lebenserfahrung“, sagt Engler. „Recherchierte Romane kennen oft die Fakten, nicht aber die kleinen Welten, in denen das Leben wirklich spielt.“ Meisterhaft beherrschten das Verwirrspiel seine literarischen Vorbilder, Autoren wie Max Frisch oder Ingeborg Bachmann.
Auch sei fraglich, ob man überhaupt eine klare Grenze zur wahren Geschichte und der Erinnerung ziehen könne. „Fakt oder Fiktion, Erinnerung oder Phantasie – die Grenzen sind ohnehin fließend. Da sind sich Literatur, Psychologie und Erinnerungsforschung einig“, sagt Engler.
Es gibt eben nicht die eine Vergangenheit, sondern viele Erzählungen. So endet der Roman: „Es ist eine Version dieser Geschichte, man könnte tausend verschiedene davon schreiben. So war es vielleicht, eventuell.“
Engler ist das Unmögliche gelungen. Der Roman ist hochanspruchsvoll, dringt vor zu den existenzialistischen Grundfragen, steckt voller Anregungen, tiefer einzusteigen in die Seelenkunde. Trotzdem macht er gute Laune, seine Sprache ist konkret und hochpoetisch zugleich, und er kommt so beschwingt und kurzweilig daher, dass er sich hervorragend als Urlaubslektüre eignet.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke